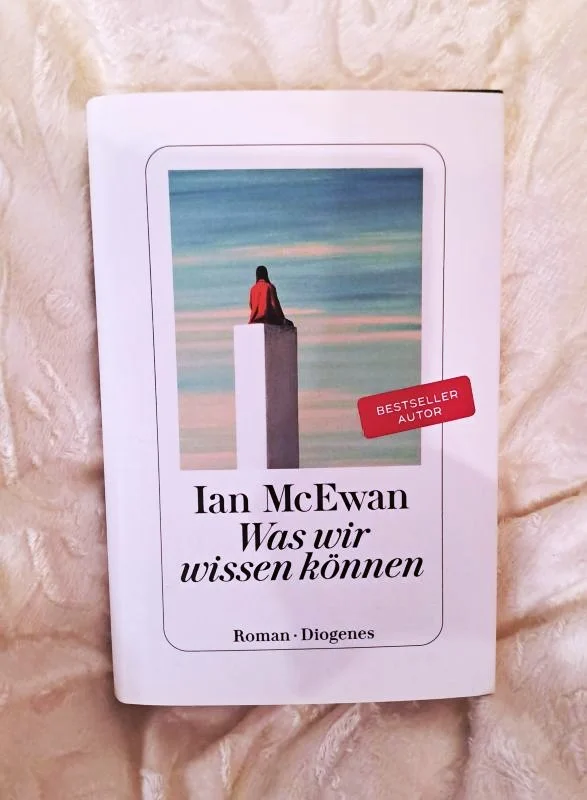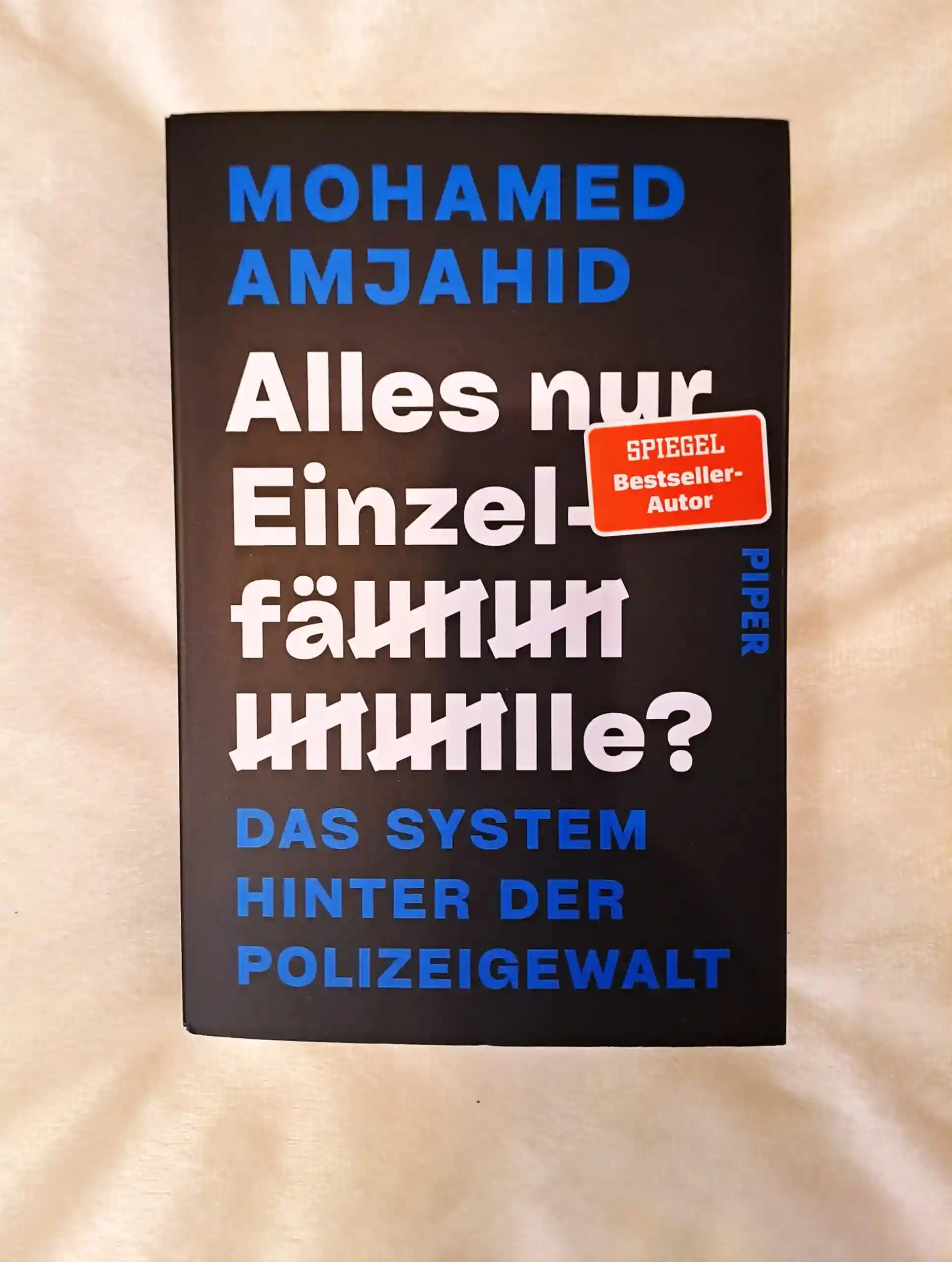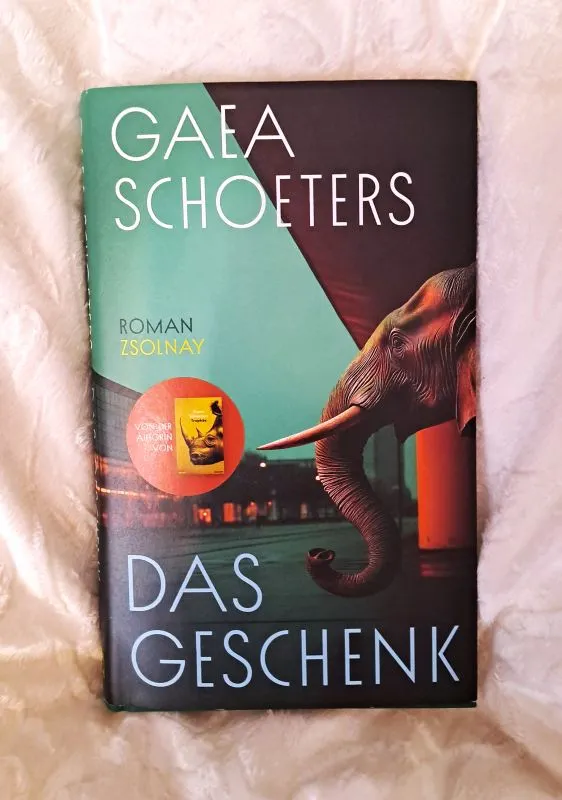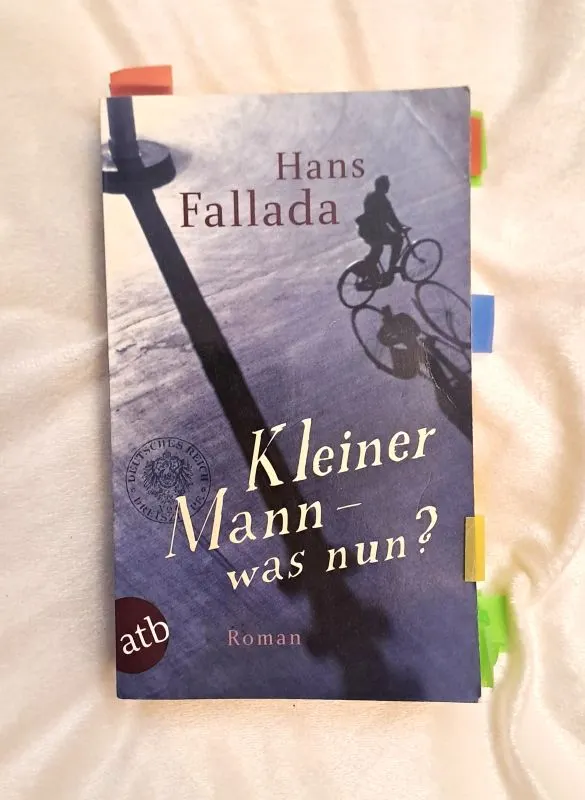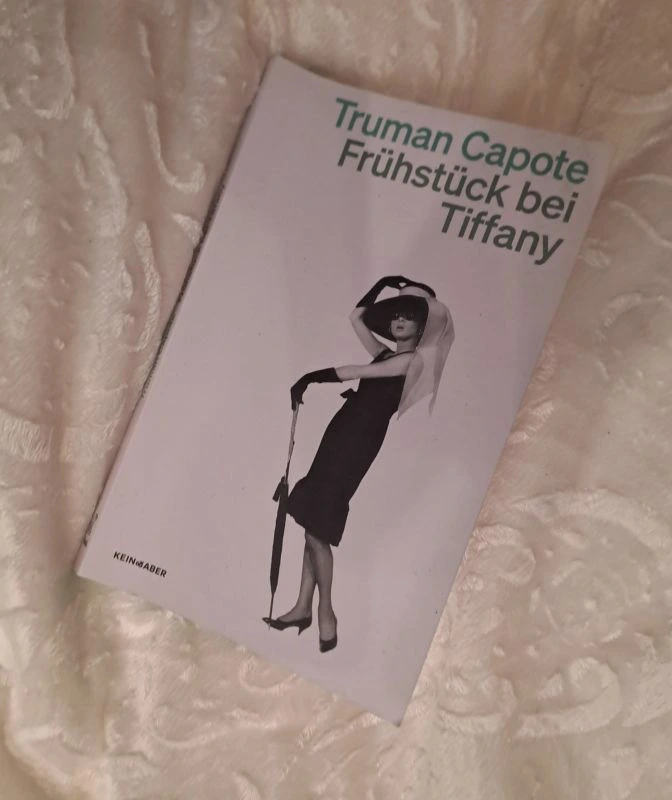Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025
Ich erinnere mich – wie oft sagen wir diesen Satz eigentlich? Mal bewusst, mal achtlos, mal automatisch und floskelhaft, mal mit einem wehmütigen Stich im Herzen, mal sehnsuchtsvoll oder im Gedanken an ein Ereignis, weil wir einen bestimmten Duft wahrgenommen haben. Dabei ist die Erinnerung an sich etwas, das eigentlich gar nicht mehr da ist, nur noch in unseren Gedanken präsent ist, dort aber große Auswirkungen auf unser Erleben im Jetzt, unser Fühlen, Denken, Handeln und unsere Wahrnehmung im Allgemeinen haben kann. Erinnerungen wirken auf unsere Zukunft ein, weil sie im Jetzt wirken – und zwar bestimmt. Wer sich das klarmacht, kann erkennen, wie flüchtig und machtlos Erinnerungen eigentlich sind, obwohl sie so wirkmächtig sind. Ein Paradoxon? Nein, keineswegs. Doch dient dieses Intro I Remember als Joe Brainards innovativstem und einflussreichstem literarischen Werk. Erstmals 1970 veröffentlicht und später mehrfach erweitert, besteht das Buch aus hunderten kurzer Einträge, die alle mit der Phrase „I remember“ („Ich erinnere mich“) beginnen. Tatsächlich hat mich die Lektüre auch an Sebalds Austerlitz erinnert mit seinen architektonischen Erinnerungsfragmenten, die sich in Gebäuden tarnen. Das wiederum hat mich an Quintilian (Marcus Fabius Quintilianus) erinnert, den römischen Rhetoriklehrer des 1. Jahrhunderts n. Chr. der sich in seiner Ausbildung des Redners auch zum Thema Gedächtnis (memoria) äußert. Dies insbesondere zur Methode der loci (Orte-Methode), bei der Gebäude und Räume als Merkhilfen verwendet werden. Wieso ich jetzt hier vom einen ins andere gerate, soll jetzt anhand Joe Brainards I Remember erörtert bzw. vorgestellt werden.
Wer war Joe Brainard?
Joe Brainard (1942–1994) war ein US-amerikanischer Künstler und Schriftsteller, der vor allem für seine vielseitigen Arbeiten in den Bereichen Collage, Zeichnung, Malerei und Literatur bekannt ist. Er wuchs in Oklahoma auf und zog später nach New York, wo er Teil der sogenannten New York School wurde – ein Kreis von Dichtern und Künstlern, zu dem etwa Frank O’Hara, John Ashbery und Ted Berrigan gehörten. Brainards Arbeiten zeichnen sich durch einen spielerischen, oft humorvollen und sehr persönlichen Stil aus. Brainard ist besonders bekannt für sein literarisches Werk I Remember (1970), eine einzigartige Autobiografie, die aus einer Reihe von Erinnerungsfragmenten besteht, die alle mit den Worten „Ich erinnere mich“ beginnen. Dieses innovative Format hatte großen Einfluss auf die Literatur und wurde von vielen anderen Autoren adaptiert.
Als bildender Künstler arbeitete Brainard in verschiedenen Medien, darunter Collagen, Assemblagen, Zeichnungen und Gemälde. Seine Werke zeichnen sich durch einen spielerischen Umgang mit der Popkultur aus, insbesondere seine Serie von „Nancy“-Collagen, die auf dem bekannten Comic-Charakter basieren.
Brainard illustrierte zahlreiche Dichterbücher. Trotz seines relativ kurzen Lebens (er starb mit 52 Jahren an den Folgen von AIDS) hinterließ er ein bedeutendes künstlerisches Erbe, das sowohl die visuelle Kunst als auch die Literatur beeinflusst hat.
Joe Brainard I Remember – Ein Buch über alle
Die ursprüngliche Ausgabe von Joe Brainards I Remember war ein schmales Buch, aber erweiterte Versionen wurden 1972 und 1975 veröffentlicht. Nach seinem Tod 1994 wurden vollständige Ausgaben herausgegeben. Paul Auster, wie Brainard ein renommierter Autor der New Yorker Literaturszene – jedoch zu einer anderen Zeit – hat I Remember sehr geschätzt und es als „an enduring part of American literature“[1] bezeichnet, womit er die Bedeutung des Werks hervorgehoben hat. Da Paul Auster den Inhalt und die Wirkung von I Remember so treffend zusammenfasst, möchte ich ihn aus dem Vorwort zu meiner Ausgabe zitieren. Das auch, weil Auster einige interessante Beobachtungen gemacht hat, die vielleicht jede und jeder schon nach dem Lesen der vorhin zitieren Zeilen unterstreichen kann.
Many people have written their own versions of I Remember sincs 1975, but no one has come close to duplicating thespark of Brainard’s original, of transcending the purely private and personal into a work that is about everybody – in the same way that all great novels are about everybody. It strikes me that Brainard’s achievement ist he product of several forces that operate simultaneously throughout the book: [1] the hypnotic power of incantation; [2] the economy of the prose; [3] the author’s courage in revealing things about himself (often sexual) that most of us would be too embarrassed to include; [4] the painter’s eyes for detail; [5] the gift of story-telling; [6] the reluctance to judge other people; [7] the sense of inner altertness; [8] the lack of self-pity; [9] the modulations of tone, ranging from blunt assertions to elaborate flights of fancy; [10], and then, most of all (most pleasing of all), the complex musical structure oft he book as a whole.
Auster, Paul: Introduction. In: Joe Brainard: I Remember. Introduction by Paul Auster. Afterword by Ron Padgett. Mirefoot 2021, S. xii.
Deutsche Übersetzung
Seit 1975 haben viele Menschen ihre eigenen Versionen von I Remember geschrieben, aber niemand ist dem Funken von Brainards Original nahegekommen – niemand hat es geschafft, das rein Private und Persönliche so zu übersteigen und daraus ein Werk zu machen, das von allen handelt – so wie alle großen Romane letztlich von allen handeln.
Es scheint mir, dass Brainards Leistung das Ergebnis mehrerer Kräfte ist, die im gesamten Buch gleichzeitig wirken:
[1] die hypnotische Kraft der Beschwörung;
[2] die Sparsamkeit der Prosa;
[3] der Mut des Autors, Dinge über sich selbst preiszugeben (oft sexueller Natur), die die meisten von uns sich nicht zu sagen trauen würden;
[4] das Auge des Malers für Details;
[5] die Gabe des Geschichtenerzählens;
[6] die Zurückhaltung, andere Menschen zu verurteilen;
[7] das Gefühl innerer Wachheit;
[8] der Verzicht auf Selbstmitleid;
[9] die Tonmodulationen, die von schroffen Feststellungen bis zu ausgefeilten Fantasieflügen reichen;
[10] und schließlich – am meisten, am erfreulichsten von allem – die komplexe musikalische Struktur des Buches als Ganzes.
Um genau zu verstehen, was Paul Auster damit gemeint hat, müsste sich wohl jeder selbst zur Lektüre bemühen.
Aufbau und Stil von Joe Brainards I remember
Das Buch folgt keiner chronologischen oder thematischen Ordnung. Stattdessen reiht Brainard Erinnerungsfragmente aneinander, die von bedeutsamen Momenten bis zu scheinbar belanglosen Alltagsbeobachtungen reichen. Ein Beispiel:
I remember the day John Kennedy was shot.
Joe Brainard: I Remember. Introduction by Paul Auster. Afterword by Ron Padgett. Mirefoot 2021, S. 5.
Ich will hier einmal eine Reihe aufeinanderfolgender Einträge aufführen – einmal im Original und einmal von mir übersetzt.
I remember in many classrooms a painting of George Washington unfinished at the bottom.
I remember okra, hominy grits, liver and spinach.
I remember carrots are good for your eyes and that beans make you fart.
I remember that cats have nine lives.
I remember ‘An apple a day keeps the doctor away’.
I remember puffed rice shot from guns. I remember ‘Snap, crackle, and pop’.
I remember an ashtray that looked like a house and when you put your cigarette down (through the door) the smoke came out of the chimney.
I remember Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Joe Brainard: I Remember. Introduction by Paul Auster. Afterword by Ron Padgett. Mirefoot 2021, S. 84.
Deutsche Übersetzung
Ich erinnere mich an ein Bild von George Washington, das in vielen Klassenzimmern hing und unten nicht fertig gemalt war.
Ich erinnere mich an Okra, Maisgrütze, Leber und Spinat.
Ich erinnere mich, dass Karotten gut für die Augen sind und dass Bohnen Blähungen machen.
Ich erinnere mich, dass Katzen neun Leben haben.
Ich erinnere mich an „Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern“.
Ich erinnere mich an Puffreis, der aus Gewehren geschossen wurde. Ich erinnere mich an „Knusper, knister, knall“.
Ich erinnere mich an einen Aschenbecher, der wie ein Haus aussah, und wenn man seine Zigarette (durch die Tür) hineingelegt hat, kam der Rauch aus dem Schornstein.
Ich erinnere mich an Rudolph, das Rentier mit der roten Nase.
Wie man sieht: Diese Mischung aus persönlichen, intimen und allgemeinen Erinnerungen schafft ein facettenreiches Porträt des Künstlers und seiner Generation, ohne dabei eine lineare Autobiografie zu konstruieren.
I Remember als literarische Zeitmaschine
Die US-Autorin Siri Hustvedt bezeichnet in ihrem Buch Die zitternde Frau Joe Brainards I Remember als Erinnerungsmaschine. Tatsächlich berichtet sie in dem Essay Das schreibende Selbst und der Patient in der Psychiatrie aus dem Essayband Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen über ihre Erfahrungen mit der schriftlichen Anwendung in ihrem Schreibkurs im Krankenhaus.
Die allerbeste Aufgabenstellung in meinem Schreibkurs habe ich von Joe Brainard stibitzt, dem bildenden Künstler und Schriftsteller, dessen Buch I Remember ein Klassiker ist, für mich jedenfalls. Es inspirierte Georges Perec zu Je me souviens sowie Horden von Schreiblehrern, die dessen bemerkenswerte Eignung als Vehikel für Erinnerungen entdeckten. […]
In Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven, das ich schrieb, als ich noch im Krankenhaus arbeitete, habe ich die Wirkung der Worte «Ich erinnere mich» beschrieben: [..] Wieder und wieder «Ich erinnere mich» zu schreiben heizt eine Erinnerungsmaschinerie an. Die Prozesse, die Erinnerung erzeugen, sind versteckt, doch es ist in diesem Kontext interessant zu fragen: «Wer schreibt?»
Aus: Hustvedt: Das Schreibende Selbst und der Patient in der Psychiatrie. In: Hustvedt, Siri: Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Essays über Kunst, Geschlecht und Geist. Aus dem Englischen von Uli Aumüller und Grete Osterwald. Hamburg 2020, S. 170-204, hier S. 195-196.
Überhaupt ist der erwähnte Essay sehr interessant für den Akt des Erinnerns beim Schreibprozess und wie dies mit der Psyche zusammenhängt. In der Tat wird gerade dieser Erinnerungsakt – hervorgerufen durch Schreiben – auch in vielen anderen Werken narrativ diskutiert. Als eindrückliches Beispiel führe ich darum hier den Kollektivroman Wir kommen auf, in dem 18 Autor:innen sich im Dialog über eher tabuisierte Themen wie Sex, Alter und Begehren austauschen.
Ich erinnere mich – mit euch zusammen
Es ist logisch, dass Joe Brainard seine Erinnerungen beginnend mit I remember verschriftlicht hat die sich aus seinem Gedächtnis und eigenen Erfahrungen speisten und aufs Papier flossen. Ich will folgend an einem Beispiel die Erinnerungsmaschinerie ankurbeln ausgehend von dem Satz „I remember screen doors that slam. And You’re letting the flies in.“ (Brainard: I Remember, S. 82.)
Zu deutsch: Ich erinnere mich an zuschlagende Fliegengittertüren. Und an: ‚Mach die Tür zu, du lässt die Fliegen rein.
Ich lese diesen Satz und beim Lesen von „Ich erinnere mich“ und der zugehörigen Erinnerung von Joe Brainard erinnere ich mich an ähnliche Ereignisse in meinem Leben. Wir hatten nämlich früher auch diese Klappmagnettüren mit Fliegennetzen an der Küchen- und Wohnzimmertür, durch die man in den Garten und auf die Terrasse gehen konnte. Wenn ich aber gerade viel im Arm hatte – vielleicht Geschirr für die nächste Party im Gartenhaus oder aber Bücher zum Lesen mit einem Getränk in der Hand – dann blieb zum Zuklappen der Tür keine Hand frei, sondern nur der Hintern oder ein Bein. Das schlug natürlich oft fehl, denn diese Magnettüren waren Sensibelchen und wollten mit Bedacht angefasst werden – Knallen und Zuschlagen der besagten Türen schlug grundsätzlich fehl. Und dann folgte eben eine entsprechende Beschwerde – es gab früher auch mehr Fliegen. Das lag vielleicht auch daran, dass gegenüber Kühe weideten oder so. Und natürlich entwickelt sich aus dieser Erinnerung dann eine weitere Erinnerung – dicke Fliegen, die am Fliegenfänger bei meiner Oma in der Küche hängen. Was habe ich die Viecher bemitleidet. Und zuletzt kommt mir dann in den Sinn, dass ich beim Einzug in meine aktuelle Wohnung eine Fliegentür für 60 Euro übernehmen sollte, die von der Vormieterin mühsam angeschraubt worden war. Mittlerweile muss ich sagen, hält sich aber der Insektenansturm auch im Sommer doch sehr im Grenzen (Klimawandel?!) und von daher lehnte ich die Übernahme dieser unnützen Tür dankend ab. Tatsächlich tut es ja auch ein Fliegennetz für 5 Euro mit Klebestreifen – wenn es denn überhaupt noch notwendig wäre. Jedenfalls – so geht es weiter – die Erinnerungsmaschinerie wurde angeworfen.
Rezeption und Wirkung von I Remember
I Remember wurde bei seiner Veröffentlichung von Kritikern gelobt und entwickelte sich zu einem Kultbuch in literarischen Kreisen. Es wurde besonders für seine Unmittelbarkeit, Aufrichtigkeit und seinen innovativen, fragmentarischen Ansatz geschätzt. Der Dichter Frank O’Hara bezeichnete es als „echte Geschichte des Bewusstseins“. Die größte Wirkung des Buches liegt in seiner methodischen Innovation. Die „I remember“-Technik wurde zu einer anerkannten literarischen Form, die zahlreiche Autoren inspirierte und in Kreativworkshops weltweit Anwendung findet. Bedeutende Schriftsteller wie Georges Perec (mit seinem Je me souviens), französische und amerikanische Autoren haben das Format adaptiert.
Kulturelle Bedeutung von Joe Brainards I remember
Das Werk wird heute als wichtiger Beitrag zur amerikanischen Literatur angesehen und:
- Gilt als herausragendes Beispiel für autobiografisches Schreiben der New York School
- Wird in Kursen für kreatives Schreiben als Modell für innovative autobiografische Techniken verwendet
- Hat die Grenzen zwischen Hochliteratur, Alltagserfahrung und Popkultur verwischt
- Wird für seine unsentimentale, aber dennoch emotionale Behandlung von queeren Themen und Erfahrungen geschätzt
✨ Warum ist I Remember so besonders?
- Es macht das Alltägliche literaturwürdig, ohne es aufzuplustern.
- Es gibt Erinnerungen Raum, die sonst vielleicht vergessen würden.
- Es zeigt, wie Identität aus winzigen Momenten zusammengesetzt wird.
- Der Leser/die Leserin findet sich selbst in den fragmentarischen Erinnerungen wieder – obwohl sie völlig persönlich sind.
Fazit zu Joe Brainards I Remember
Die literarische Erinnerungsmaschinerie von Joe Brainard ist einzigartig und eine wertvolle Lektüre, für alle die sich wieder an die Dinge erinnern wollen, die sie längst vergessen haben. Es ist ein zeitloses Buch, dass Zeitlinien spinnt und von hier nach dort und wieder woanders hinspringt, aus der eigenen Geschichte in die des Kollektivs und in die Geschichten anderer Menschen und in die unsere – wenn wir lesen. Ich kann aus eigener Erfahrung versichern, dass die Vielfalt von Joe Brainards persönlichen Erinnerungen die verschiedenartigsten Erinnerungen bei der Lektüre wachrufen. Ich habe mich auch an vieles erinnert, an das ich ohne den Text überhaupt nie gedacht hätte. Es braucht Erinnerungsnetze, die Verbindungen anstupsen und wachrütteln oder triggern. Das letzte Wort benutze ich nicht so gern, weil es auch einen negativen Klang hat, je nachdem, in welchem Kontext man es liest. Aber gerade das gilt ja auch für Erinnerungen, sie können positive, neutrale aber auch unangenehme und vergrabene, verschüttete und traumabelastete Erinnerungen wachrufen. Und Schreiben ist in der Tat ein reinigender und klärender Prozess in vielfacher Hinsicht. Es gibt das Buch übrigens auch auf Deutsch. Viel Spaß!
- Der Zauberer von Oz: Conditio humana im blinden Fleck der Figuren – 10. Februar 2026
- Tristan und Isolde im Kartenspiel: Zwischen mittelalterlicher Tradition und romantischer Umdeutung – 12. Januar 2026
- Das Jesus Video – Andreas Eschbachs Science-Fiction-Thriller über Zeitreisen und Glauben – 24. Dezember 2025
Verwendete Literatur
Auster, Paul: Introduction. In: Joe Brainard: I Remember. Introduction by Paul Auster. Afterword by Ron Padgett. Mirefoot 2021, S. ix- xx.
Brainard, Joe: I Remember. Introduction by Paul Auster. Afterword by Ron Padgett. Mirefoot 2021.
Hustvedt: Das Schreibende Selbst und der Patient in der Psychiatrie. In: Hustvedt, Siri: Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Essays über Kunst, Geschlecht und Geist. Aus dem Englischen von Uli Aumüller und Grete Osterwald. Hamburg 2020, S. 170-204.
[1] Auster, Paul: Introduction. In: Joe Brainard: I Remember. Introduction by Paul Auster. Afterword by Ron Padgett. Mirefoot 2021, S. ix- xx, hier S. xx.
Bildquellen
- maze-2264_640_PublicDomainPictures auf pixabay: maze-2264_640_PublicDomainPictures-auf-pixabay.jpg