Zuletzt bearbeitet am 27. Dezember 2024
Dieser Beitrag entstand als Studienarbeit in einem Seminar der mittelalterlichen Literatur im Sommer 2019.
Schreiben ist eine Kunst – natürlich zuvorderst ein Handwerk, das es zu erlernen gilt. Das war so – das ist so. Dass jedem geschriebenen Wort eine Intention innewohnt, die an Rezipienten gerichtet möglicherweise zur Aktion oder mindestens zum Nachdenken (und natürlich auch zum Konsumieren) auffordert, ist eine diesem Essay zugrundeliegende These. Jemand, der das Schreiben als Handwerk beherrscht und es zur Kunst umformen kann, der besitzt Macht und damit einhergehend Verantwortung. Figuren und Schreiben, das gehört zusammen, denn Figuren tragen diese Macht, die Literaturschaffende durch ihr Können besitzen. Sie können durch Worte Einfluss nehmen auf Gegenwart und Zukunft, ungewöhnliche Denkweisen aufzeigen, Rezipienten zum Nachdenken anregen, literarisch Aspekte des gesellschaftlichen Lebens beleuchten, diese negieren oder erhöhen. Sie können implizit eigene Vorstellungen in ihre Werke einbauen, die möglicherweise den traditionellen Horizont alteingesessener Vorstellungswelten sprengen und neue, moderne Ansichten literarisch am Reden und Handeln von Figuren zur Diskussion stellen. Durch die Macht der Worte können bestehende Ordnungen und Machtverhältnisse und damit auch Diskurse eventuell neu verhandelt werden. Genau das macht Schreiben zu einer Kunst – unabhängig von jeder Epoche.
Figuren: Wolfram und Parzival
Ein mittelalterliches Beispiel ist Wolframs von Eschenbach ‘Parzival’, in dem auch der Orientdiskurs entgegen der zeitgenössischen Realität behandelt wird. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts sind mit dem Vierten Kreuzzug, der 1204 mit der Eroberung und Plünderung Konstantinopels endet, blutige Auseinandersetzungen zwischen Heiden und Christen aktuell. Erstaunlich ist, dass Wolfram die Kreuzzugsthematik und den damit einhergehenden Glaubenskonflikt fast gänzlich ausblendet. Er mischt sich allerdings dichterisch in diesen ein.
Dabei stehen alle scheinbaren Widersprüche, indirekten Einsprüche und Gegenentwürfe im Einklang mit seinem im Prolog benannten Gleichnis des elsternfarbigen Menschen, der nicht nur weiß (gut bzw. christlichen Glaubens) oder schwarz (schlecht bzw. Heide) ist, sondern beides in sich trägt. Die Schwarz-Weiß-Thematik lässt sich grundsätzlich aber auf alle möglichen zwischenmenschlichen Gepflogenheiten anwenden. Dahinter steckt auch die Frage, was überhaupt als gut und böse bezeichnet werden kann. Dieser gemischte Menschentypus, lässt sich prinzipiell an allen Figuren in Wolframs Werk mehr oder weniger aufzeigen. Solch ein Programm kann als äußerst modern betrachtet werden.
Figuren: Cundrie
So ist die aus dem Orient stammende Gralsbotin Cundrie eine von Wolfram synthetisch inszenierte Figur. Auf einem Maultier reitend (kein Zelter, wie es Damen vorbehalten ist) hat der Dichter sie körperlich animalisch inszeniert (Fell im Gesicht und Eberzähne usw.), dabei trägt sie jedoch höfische Kleidung. Sieht sie so aus, weil sie aus dem Orient stammt? Sind hier biblische Kenntnisse um die Verfehlung Adams enthalten? Des Weiteren ist sie äußerst gebildet und zudem noch im Auftrag des Grals, also im Auftrag Gottes, unterwegs. Cundrie besitzt zwar nicht die äußere höfische Schönheit, dafür aber innere – sie zeigt eine große Mitleidsfähigkeit, als sie von Parzivals Frageversäumnis erfährt und leidet mit Gralskönig Anfortas. Mitleid als christliche Tugend wird an Cundrie direkt ausgestellt. Und da sie für den Gral tätig ist, zeigt Gott sein Vertrauen in sie.
An ihr werden interdiskursiv die Theologie, Höfischkeit, der Orient, aber auch Gewalt gegen Frauen verhandelt. Denn Cundrie ist aufgrund ihrer animalischen Darstellung so hässlich, dass sie niemand minnen wollen würde – ihr fast schon monströses Aussehen hat also einen Grund. War das nun Gottes Wille? Vielleicht sollte man einmal bei Augustinus nachschlagen. Gott zumindest hat aber im Orient (der ja erst noch missioniert werden muss) gar keine Macht – oder doch? Mit ihrem (wenn man es so sagen will) von Gott gegebenen Aussehen läuft Cundrie also nicht einmal im Ansatz Gefahr auf ihren Botengängen von umherziehenden Rittern vergewaltigt zu werden. Damit wird an ihrer Figur indirekt auch auf den Ritter- und Rechtsdiskurs eingegangen.
Figuren: Wigalois
Der ‘Wigalois’ des Wirnt von Grafenberg geht ebenfalls interdiskusiv auf den höfischen sowie den theologischen Diskurs ein. Japhite steht im Einklang mit dem mittelalterlichen Bild der höfischen Dame, sie erfüllt narrativ das Weiblichkeitsideal und besitzt sämtliche weibliche Tugenden, insbesondere triuwe – aber sie ist auch ungetaufte Heidin. Auch stirbt sie dem geliebten Mann nach dessen Tod folgsam hinterher, ihr Gehorsam gegenüber dem Teufelsbündler Roaz wird gelobt. Dies steht im Widerspruch zueinander – treu bis in den Tod gegenüber dem Mann, das ist in Ordnung, aber ob das auch für eine Heidin gilt, deren Mann mit Satan verbündet ist? Ideal ist das nicht. Gehorsam gegenüber einem Heiden scheint im zeitgenössischen Kontext der Häretikerverfolgung und Missionsanliegen der Kirche unangebracht. Der Liebestod wird jedenfalls idealisiert – Japhite ist bereit Roaz in die Hölle zu folgen – ihre triuwe wird hier deutlich hervorgehoben und damit ihre Höfischkeit als ideale Dame. Dabei wird erwähnt, dass eben diese triuwe, Japhite vor der ewigen Verdammnis rettet, obwohl ihr eigentlich als Heidin der Weg in den Himmel verwehrt ist.
Auffällig scheint hier die Konzentration auf die triuwe. Das Nachsterben ist ein Muster der höfischen Literatur, die höfische Frau ist prinzipiell an den Mann gebunden, sodass sein Tod sie entsprechend auch verblassen lässt. Könnte in Bezug auf Japhite und ihre Liebe zu dem Teufelsbündler möglicherweise eine intertextuelle Verbindung zur Sigune Wolframs aufgemacht werden, deren triuwe ebenfalls „überirdisch groß“ ist? Interdiskursiv miteinander verwoben wären in beiden Fällen Diskurse um Ritterschaft und Theologie. Im Falle von Japhite und Roaz zumindest können der höfische und theologische Diskurs aufgezeigt werden, wobei die betonte triuwe Japhites im Gegensatz zum zeitgenössischen Wissen steht – ungetaufte Menschen kommen nicht in den Himmel – da bleibt Gott nun einmal hart (obwohl seine Wege eben auch unergründlich sein können).
Figuren: Tristan und die Bildung
Im ‘Tristan’ Gottfrieds von Straßburg ist es unter anderem der Kindererziehungsdiskurs, der entgegen zeitgenössischem Wissen aufbereitet wird. Tristan ist der höfisch-ritterlich-intellektuell-hochbegabte Streber schlechthin: Er lernt und lernt und lernt und weiß in kürzester Zeit in jüngstem Alter mehr als manch ein Weiser auf dem Sterbebett. Was Wolframs Parzival zu wenig lernt, lernt er zu viel. Der Junge wird nicht wie ein Königssohn erzogen, er ist Künstler, Intellektueller, mitunter auch fast Kleriker. Die mittelalterliche Erziehung zum Ritter ist für Jungen allerdings normal, doch Tristans Erziehung gleicht narrativ auch dem Heldenschema und steht damit im Widerspruch zu dem zeitgenössischen Wissen um Kindeserziehung adeliger Jungen. Gerade dies ist für die Identität der Figur und den späteren Handlungsverlauf wichtig: Tristan muss strukturell gesehen eine enorme Bildung besitzen – er könnte sonst unter anderem gar nicht Isoldes Lehrer werden, würde ja erst gar nicht entführt. Und wer weiß, ob jemand mit weniger Bildung die Geliebte voller Pflichtbewusstsein wieder hergegeben hätte. Mitunter sind Bildung und Moral jedoch zwei völlig verschiedene Dinge, die hier allerdings nicht weiter ins Gewicht fallen.
Herrscher oder nicht Herrscher?
Das enorme Wissen stellt sich auch als Belastung für ihn dar. Alle Bildung hilft eben nichts, wenn der Held sich von Affekten steuern lässt. Dies geschieht etwa, wenn Tristan den Mörder seines Vaters bei Verhandlungen tötet. Diese Handlungsweise entspricht nicht den gängigen Rechtspraktiken und dürfte zum zeitgenössischen Gewaltdiskurs gezählt werden. Alle Bildung ist demnach nichts gegen die Macht der Gefühle. Zorn und Liebe sind mächtiger als Wissen, dies könnte an Tristan aufgezeigt werden und damit eine weitere Erklärung für seine überdimensionale Bildung sein. Immerhin lässt er sich bei seiner Affäre mit Isolde auch von seinen Gefühlen steuern und ist nur in der Öffentlichkeit der vorbildliche Untertan Markes, im Geheimen dagegen ein Betrüger. Andererseits macht Gottfried seinen Tristan zum angemessenen Herrscher auf fast allen Ebenen – Tristan stutzt sogar Marke zurecht, als dieser seine Frau verspielt.
Wie Tristan und Marke in Bezug auf ihr Handeln im Rahmen eines angemessenen Herrscherverhaltens vom zeitgenössischen Publikum eingeschätzt worden sind, lässt sich nicht nachvollziehen. Wird hier von Gottfried vielleicht ein Diskurs um Legitimität der Herrschaft und Erbfolge angeschnitten und kritisiert er indirekt bildungsferne Herrscher (die Fähigkeit zum Lesen dürfte auch für zeitgenössische Herrscher mancherorts vorteilhaft gewesen sein)? Diese Frage muss zunächst offenbleiben. Und eigentlich erübrigt sie sich auch, denn auch Tristan weiß, dass der König das Sagen hat und er sich dieser herrschaftlichen Instanz zumindest öffentlich beugen muss (obwohl er wissentlich mit seiner Liebesaffäre zu Isolde eindeutig das Falsche tut – oder sind Handlungen aus Liebe generell gestattet?).
Gewalt gegen Frauen
Gewalt und vor allem Gewalt gegen Frauen ist ebenfalls ein Diskurs, der im ‘Parzival’ Wolframs aufgegriffen wird und teilweise schon an Cundrie aufgezeigt worden ist. Ein weiteres Beispiel wird an Orilus‘ Frau Jeschute inszeniert. Sie wird Opfer des ignoranten Parzival, der sie in ihrem Zelt überrascht und überfällt. Orilus verdächtigt seine Frau später, sich einem anderen hingegeben zu haben und bestraft Jeschute massiv: Er kündigt die Gemeinschaft von Tisch auf Bett auf und deklassiert sie. Jeschute muss sich fügen. Die Deklassierung ihrer Figur wird später aufgrund ihrer in Lumpen gekleideten Gestalt allzudeutlich. In dieser Position findet der Erzähler Zeit, anzügliche Witze zu reißen – schließlich ist ihr nackter Körper unter ihrer ehemals vortrefflichen Kleidung deutlich zu erkennen. Sie wird zum sexualisierten Opfer des Erzählers – und wohl auch für die Rezipienten. Ob hier jemand Mitleid hatte, ist nicht nachvollziehbar.
Durch entsprechende Erzählerkommentare kann davon ausgegangen werden, dass Parzival, wäre er sexuell erfahrener gewesen, die Situation entsprechend ausgenutzt hätte. Wichtig ist hier aber, dass es nicht dazu gekommen ist. Parzival ist es, der Jeschute letztlich durch den Kampf mit Orilus rehabilitieren kann und damit seine Schuld, durch welche die Situation erst entstanden ist, wiedergutmacht. Orilus hingegen wird indirekt durch den Erzähler das grundlose Urteil gegen die unschuldige Jeschute und damit Hartherzigkeit vorgeworfen. Konterdiskursivität scheint hier sehr subtil auf. Im Gesamtwerk und im Hinblick auf Wolframs Programm kann durchaus ein Einspruch zum Diskurs Gewalt gegen Frauen auch bei der Figur Jeschute festgestellt werden, wobei es möglicherweise gerade die sexualisierte und degradierte Ausstellung ihrer Figur ist, die zu jener Konterdiskursivität beitragen könnte.
Parzival
Ein weiterer Aspekt, der an Jeschute aufgemacht wird, ist das deutliche Zurschaustellen ihrer körperlichen Reize, als Parzival sie sieht. Man könnte fast meinen, der Arme könne nichts für sein Verhalten, Jeschute hätte prinzipiell ja selbst schuld, dass der Tölpel sich an ihr vergreifen will – wie Frauen allgemein (und auch heute noch in derartigen Situationen nachgesagt bekommen). Im Zusammenhang mit einer im Text thematisierten Vergewaltigung einer Botin des Artushofes ist es gerade Gawan, der hier diese Meinung vorbringt, den Vergewaltiger verteidigt und eine Milderung der Strafe erwirkt. Seine spätere Angetraute Orgeluse lässt den Vergewaltiger letztlich eine gerechte Strafe zukommen – und das ist einzig der Tod (wobei hier eine Kritik am ungerecht urteilenden Artushof implizit ist). Erkennbar sind hier dichterische Stellungnahmen auf den Rechts- und Minnediskurs, denn Gawan ist bei Wolfram mehr ein Minneritter, der „nichts anbrennen lässt“, wobei er in anderen Werken mehr von einem tadellosen, stets vorbildlichen Ritter besitzt.

Figuren: Orgeluse
Noch interessanter in Bezug auf die Thematik von Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit dem höfischen Kalokagathie-Prinzip ist Orgeluse. Dargestellt wird sie als Verführerin, eine Femme fatale, die Männer anlockt, um sie dann in ihr Verderben stürzen zu lassen. Rache ist ihr Anliegen: Ihr Geliebter Gramoflanz wurde beim Tjost getötet und sie leidet immens unter seinem Tod. Als Frau kann Orgeluse trotz ihrer Stellung als Landesherrin nicht selbst Rache nehmen. Sie braucht einen männlichen Kämpfer, der dies für sie übernimmt. Wie gut, dass sie als Adelige zumindest äußerlich dem höfischen Schönheitsideal entspricht. Und da Ritter im literarischen Mittelalter auch Frauendienst bestreiten müssen, kann sie sich ihre Verehrer deshalb quasi aussuchen.
Dass sie die naiven Herren dann verspottet und verhöhnt, steht entgegen dem höfischen Ideal der perfekten Frau – das aber scheint die Ritter nicht zu stören. Sie lassen sich im Sinne des Systems von ihr instrumentalisieren, alles andere, außer dem Ehrgeiz, Orgeluse dienen und minnen zu wolle,n scheint im Angesicht von Ehrerwerb durch Aventiure nicht wichtig. Orgeluse könnte so stellvertretend für die Verspottung des Frauendienstes, des Rittersystems und der damit zusammenhängenden Gewalt angesehen werden. Dass sie zudem auch autonome Landesherrin ist, dürfte im patriarchalischen Mittelalter auch nicht gern gesehen worden sein.
Elsternfarbigkeit
Orgeluse ist also nach zeitgenössischem Wissen eine eher problematische Figur: Sie besitzt über weite Strecken der Handlung autonome Handlungsmacht, instrumentalisiert die Männer für ihre Zwecke und zudem ist sie auch am Leiden des Gralskönigs Anfortas Schuld – der hatte sich ebenfalls vorgenommen, die Schöne zu erobern – und war kläglich gescheitert (und leidet seitdem an einer demonstrativ auf den Minnedienst hinweisenden Strafe). Mit ihren Spottreden ist Orgeluse ebenfalls ein Gegenbild zur höfischen Dame, sie ist außen schön, aber scheint innen hässlich. Selbst ihre eigenen Untertanen reden schlecht von ihr. Nur der Erzähler verteidigt sie – eine Verurteilung, bevor man sich ein Bild gemacht hat, scheint ihm falsch. Schwingt hier etwa das angedeutete graue Menschenbild mit?
Shades of Grey im Mittelalter?
Schwarz und weiß – Orgeluse scheint ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit zu präsentieren, doch eigentlich sieht es ganz anders aus. Der Erzähler hat recht. Denn Orgeluse ist selbst Opfer des ritterlich-höfischen Systems, dessen sie sich nun für ihre eigene Rache bedient. Fragen, die durchaus ambivalent zu betrachten sind, wäre daher: Trägt Orgeluse als Frau die Schuld an der Misere, die über der Gralswelt liegt? Oder ist es das ritterlich-höfische System, das von Männern erfunden, nicht funktioniert und Änderungen bedarf? Wolfram lässt dies dichterisch gekonnt im Dunkeln. Aber anhand der Figur Orgeluse könnte eine möglicherweise vorhandene indirekte Kritik an zeitgenössischen Diskursen gar nicht deutlicher sein. All das macht sie zu einer Figur, die ganz im Zeichen des Wolfram’schen Elsternprogramms steht.
Doch Wolfram muss sich zeitgenössischen Diskursen beugen bzw. diesen zumindest Tribut zollen: Orgeluse wird am Ende verheiratet. Auf ihre Rache für den Geliebten Gramoflanz muss sie verzichten, muss der Versöhnung zustimmen und ihre autonome Position als Landesherrin aufgeben. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, dass an ihrer Figur Diskurse um Gewalt gegen Frauen und Männer, Ritterschaft und Höfischkeit verhandelt werden, die konträr gegen damaliges Wissen laufen. Und Orgeluse ist eine der Hauptfiguren. Wolfram versteht es, sie als Figur narrativ indirekt in sämtliche Handlungsstränge einzuflechten. Kein Autor weist einer unwichtigen Figur eine derart signifikante Rolle zu (möchte ich behaupten) – wobei Wolfram ein solch ausgefeiltes Netz an Figurenkonstellationen geschaffen hat, in dem jede quasi jeder Figur eine tragende Rolle zukommt. Und sämtliche interdiskursive und konterdiskursive Verhandlungen lassen sich auch an weiteren Figuren beobachten.
Figuren als Kunstobjekte
Schreiben ist eben eine Kunst – und jeder Autor beherrscht sein Handwerk anders. Ob hinter dem geschriebenen und überlieferten Wort eine bestimmte Intention im Hinblick auf zeitgenössische Diskurse steckt, ob die Dichter sich tatsächlich indirekt und im Sinne einer konterdiskursiven Einmischung an mittelalterliche Rezipienten wenden, lässt sich aus moderner Perspektive nurmehr anhand verschiedener Parameter untersuchen. Aufgrund der Abweichungen vieler Werke im Hinblick auf zeitgenössisches Weltwissen und mittelalterliche Diskurse kann jedoch davon ausgegangen werden, dass nicht nur überbordende Fantasie der Dichter oder Sonderwünsche ihrer Förderer dem Erschaffen der Figuren zugrunde liegen. Und gerade das macht die Untersuchung der mittelalterlichen Texte auch interessant für weitere Forschungsarbeiten. Dabei spielen Widersprüche zwischen Text und zeitgenössischen Diskursen sowie Wissen eine besondere Rolle, welche die Arbeit an weiteren Forschungsfragen spannend gestalten.
[starbox]Verwendete Quellen:
Gottfried von Straßburg: Tristan. Band 1–3. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Friedrich Ranke neu hrsg., ins Nhdt. übersetzt, mit einem Stellenkommentar und Nachwort von Rüdiger Krohn.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois. Text der Ausgabe von J. M. N. Kapteyn, übersetzt, erläutert und mit einem Nachwort versehen von Sabine Seelbach und Ulrich Seelbach. 2., überarb. Aufl. Berlin/Boston 2014.
Wolfram von Eschenbach: Parzival (Band I und II). Nach der Ausgabe Karl Lachmanns revidiert und kommentiert von Eberhard Nellmann, übertragen von Dieter Kühn, Frankfurt am Main 2015.
Bild: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) — Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340, fol. 149v, online unter: https://doi.org/10.11588/diglit.2222#0294 (zuletzt abgerufen am 11.08.2023).
Bildquellen
- Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) — Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340, fol. 149v, online unter: https://doi.org/10.11588/diglit.2222#0294 (zuletzt abgerufen am 11.08.2023).: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) — Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340, fol. 149v
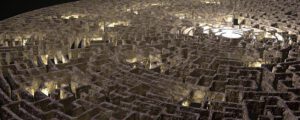



![Titelbild Koster, Henry: The Bishop’s Wife [Film]. Samuel Goldwyn Productions. United States 1947.](https://literarische-gedankenexperimente.de/wp-content/uploads/2025/03/Jede-Frau-braucht-einen-Engel-Screen-300x137.png)

