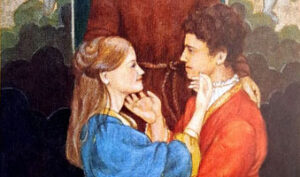Zuletzt bearbeitet am 10. Januar 2025
23. Dezember – Literarischer Weihnachtskalender 2024
Ein Meisterwerk ist Parzival, eines der bedeutendsten Werke höfischer Literatur des Mittelalters, verfasst von Wolfram von Eschenbach um 1200-1210. Ich würde auch irgendwie meine Liebe für die mittelalterliche Literatur und meine Abschlussarbeiten in dem Bereich verhehlen, wenn ich in diesem Kalender nicht mindestens eines dieser großartigen Werke unterbrächte. Das Nibelungenlied war mir zu dramatisch, das habe ich auch schon in meinem Beitrag zur strukturellen Gewalt gegen Frauen behandelt (der Beitrag ist übrigens eine Abwandlung meiner Bachelorarbeit), auf Tristan hatte ich keine Lust und Lancelot kenne ich zu wenig (auch wenn ich mich konkreter mit Merlin und Vivianne beschäftigt habe und mich noch mit Artus und Ginover auseinandersetzen muss). Parzival also – der Narr, der Idiot, der unwissende Depp! Haben wir nicht alle einen Anteil an Parzival? Seine Reise beginnt mit unserer Lektüre. Am Ende ist nicht nur er schlauer, sondern auch wir. Also, worum geht es in Wolframs Parzival?
[et-toc]
Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 304 – 495) — Wiesbaden, 2007
Wolframs von Eschenbach Parzival ist lesenswert, weil …
🗡️ die Figurenvielfalt und ihre Entwicklung faszinierende Einblicke in die Gesellschaft und Kultur des Mittelalters geben.
🗡️ er zeitlose Themen wie Schuld, Vergebung, Liebe und Selbstfindung auf poetische Weise behandelt.
🗡️ die Suche nach dem Gral als Symbol für spirituelle Erfüllung auch heute noch aktuell ist.
🗡️ das Werk die höfische Kultur und ihre zeitgenössischen literarischen Diskurse kunstvoll in eine universelle Geschichte verwandelt.
🗡️ die Sprache und Symbolik Wolframs eine dichte und zugleich poetisch sowie spannende Erzählung schaffen.
🗡️ er nicht nur ein Gralsroman, sondern auch ein Werk über die menschliche Natur und ihre Suche nach Sinn ist.
🗡️ der Roman sowohl eine historische Quelle als auch ein Werk voller aktueller Bezüge zur menschlichen Erfahrung ist.
Eine Zusammenfassung der Handlung von Parzival
Parzival illustriert den Weg des Menschen zur inneren Reife. Fehler, Reue und die Suche nach Gott führen letztendlich zur Vollendung. Es ist eine Geschichte über das Streben nach persönlicher und spiritueller Vervollkommnung, aber es geht auch um die Frage nach Menschlichkeit, nach vergessener oder verlorener Humanität im gemeinsamen Miteinander (wie es letztlich auch bei Melvilles Moby-Dick oder sogar Till Eulenspiegel der Fall ist). Abseits der ganzen vermeintlich stereotypisch erscheinenden Figuren und ihrer durch mittelalterliche Lesart verfremdeten Darstellung ist es doch das, was übrigbleibt und was auch durch die berühmte Parzival-Frage (wenn Parzival den verletzten Gralskönig Anfortas – der sein Onkel ist – nach seinem Leiden fragt) evoziert wird. Nach vielen Abenteuern und Gesprächen stellt die rettende Frage und wird zum neuen Gralskönig gekrönt, wobei er der Gesellschaft Frieden und Erlösung bringt.
Die Figur des »tumben Narren« Parzival
Parzival wird zunächst als»tumber Tor« oder »tumber Narr« dargestellt, ein unerfahrener, unwissender und naiver junger Mann, der Ritter aufgrund ihrer in der Sonne blitzenden Rüstung für Engel hält. Er kann nichts für seine Unwissenheit, denn seine Mutter Herzeloyde hat ihn abseits der höfischen Gesellschaft isoliert erzogen, weil sie nicht möchte, das er auch durch das Dasein als Ritter getötet wird wie sein Vater Gahmuret. Wo andere Jungen entsprechende Erziehung und Umgangsformen erlernt hätten, wird er um seinen königlichen Lebensstil betrogen. Man kann das irgendwo nachvollziehen, sie möchte ihn beschützen. Auf der anderen Seite aber ist Parzival eine große Zukunft beschert, vor der sie ihn zurückhält. Das Schicksal lässt sich aber nicht betrügen.
Diese Unwissenheit ist der Katalysator der Handlung, denn Parzival begeht gerade wegen diesem fehlenden Wissen Fehler. Er versteht die Ratschläge seiner Mutter falsch, sodass es zu einem folgenschweren Zwischenfall mit Jeschute, der Frau von Orilus kommt, was zu Missverständnissen führt. Sein Weg ist ist von Fehlern und Missverständnissen gepflastert. Er versäumt zudem bei seinem ersten Besuch auf der Gralsburg seinen Onkel, Gralskönig Anfortas, nach seinem Leiden zu fragen, also die entscheidende Frage zu stellen. Hätte er diese Frage gleich gestellt, so wäre seine weitere Reise, seine Zweifel, die vielen Zusammentreffen mit anderen Figuren und sein Lernprozess gar nicht notwendig. Doch Parzival muss reifen und daher reisen und daher Wissen erlangen. Er durchläuft auf seiner Heldenreise einen Entwicklungsprozess zu spiritueller und individueller Reife, den wir Menschen in der ein oder anderen Form ebenfalls in unserem Leben durchlaufen. Es geht um das Erlangen von Mitgefühl, von Verantwortungsbewusstsein und Wissen.
Ein Vorgeschmack auf Wolframs Parzival
Ich möchte auch hier eine Szene zur Verfügung stellen und habe mich für die berühmte Blutstropfenszene entschieden. Es ist Mai und hat über Nacht erstaunlicherweise geschneit, sodass der umherreisende Parzival unter einer leichten Schneedecke bedeckt ist. Zur gleichen Zeit verlässt Artus mit seinem Gefolge seinen Hof auf Kardiol, um den roten Ritter (das ist Parzival) zu suchen. Sein bester Falke entwischt, trifft auf Parzival und übernachtet bei ihm – das ist die Nacht, in der es geschneit hat. Als er am nächsten Morgen Wildgänse aufscheucht und eine verletzte Gans drei Blutstropfen im weißen Schnee verliert, wird Parzival in eine Art Liebestrance versetzt, weil ihn das Rot auf Weiß an seine geliebte Cundwier âmûrs erinnert, eine schöne Dame, die er zuvor aus einer brenzligen Situation errettet und eine Nacht mit ihr verbracht hat. Jedenfalls wird er in seiner Liebestrance von Artusrittern angegriffen, die den mit erhobener Lanze im Feld stehenden Ritter falsch einschätzen. In den entscheidenden Momenten während des Kampfes, kann Parzival wieder zu klarem Verstand gelangen, weil ihm der Blick auf die Blutstropfen verwehrt wird, sodass er die Lanze senken und die Angreifer besiegen kann. Doch diese Augenblicke dauern nur kurz, sodass er die Gegner im Handumdrehen ausschaltet, danach wieder in seiner Liebestrance versinkt. Erst der Ritter Gâwân holt ihn als endgültig aus seiner Gefangennahme durch Frau Minne (die Liebe), indem er die Blutstropfen mit seinem Mantel abdeckt. Ich werde die neuhochdeutsche Übersetzung als Fließtext abbilden, die mittelhochdeutschen Verse dann eben so.
Parzivals Liebestrance in der Blutstropfenszene
Als er die Blutstränen sah auf dem Schnee, der war ganz weiß, da dachte er: ›Wer hat so viel Kunst in diese Farbe gelegt, daß sie so sehr leuchtet? Cundwier âmûrs, diese Farbe kann sich wahrhaftig dir vergleichen. Mich will Gott selig machen, da Er mich hier etwas finden ließ, das dir gleicht. Gelobt sei Gottes Hand und Seine ganze Schöpfung. Cundwier âmûr, hier liegt dein Glanz. Und weil der Schnee sein Weiß dem Blut entgegenhält und dieses den Schnee so rot gemacht hat, Cundwier âmûr, so gleicht es deinem beau corps, das kann dir nicht verschwiegen werden.‹ Des Helden Augen maßen das Muster, wie es sich ergeben hatte: Da lagen zwei Tränen auf ihren Wangen, die dritte war die an ihrem Kinn. So gab er sich wahrer Liebe zu ihr hin, nichts konnte ihn von ihr ablenken. Er versank mehr und mehr in Gedanken, ganz ohne Bewußtsein hielt er schließlich. Die mächtige Liebe herrschte über ihn: Solche Fesseln legte seine Frau ihm an. Den Farben glich der Leib der Königin von Pelrapeire, die hatte ihm das Bewußtsein geraubt. So hielt er da, als ob er schliefe.
[…]
So fuhr der Held, er wußte es halt nicht besser, dahin zu dem, der Sklave der Liebe war. Er schlug ihn nicht, noch stach er zu, sondern er sprach ihn zuerst an, und zwar mit einer Kriegserklärung. Parzivâl stand da und nahm nichts wahr. Jene Zeichen aus Blut hatten ihm das angetan und eine strenge Dame, die Liebe nämlich, die oft auch mir die Sinne raubt und mein Herz unruhig pochen läßt.
[…]
Hört aber nun weiter von jenen zweien, wie sie zusammenkamen und wie sie sich trennten. Segramors sprach so: »Mein Herr, Ihr benehmt Euch, als wärt Ihr gar noch froh darüber, daß hier ein König lagert und sein Kriegsvolk. Da könnt Ihr nun noch so gleichgültig tun, Ihr müßt ihm doch dafür Buße zahlen, oder ich will selber das Leben verlieren. Ihr sucht Streit, darum seid Ihr so nahe hergeritten. Doch aus Courtoisie will ich Euch vorher bitten: Ergebt Euch in meine Gewalt, sonst wird die Rechnung gleich beglichen sein, und Euer Fallen wird den Schnee stauben lassen. Ihr tätet es also besser vorher und in Ehren.« Auf diese Drohung antwortete Parzivâl gar nichts; seine Gebieterin, die Liebe, redete ihm von anderem Leid. Der kühne Segramors warf sein Pferd herum, um es in Stellung zu bringen. Da wandte sich auch der Kastilianer, auf dem Parzivâl saß, der Schöne, immer noch völlig abwesend, und nun stand das Pferd über dem Blut: Sein Blick wurde so davon abgekehrt. Das geschah zu seinem Ruhm; denn sobald er nichts mehr von den Tränen sah, gewann die Vernunft Gewalt über ihn und ließ ihn wieder zu Sinnen kommen. Schon kam da auf ihn zu rot Segramors. Den Speer von Troys, stark und aus zähem Holz, hübsch angemalt, wie er ihn fand vor der Klause, den senkte er in seiner Hand. Eine Tjost durch den Schild nahm er entgegen, doch seine eigene Tjost wurde so zum andern hinüber gezielt, daß der gewaltige Segramors sich bequemen mußte, seinen Platz im Sattel zur Verfügung zu stellen; dabei war der Speer doch ganz geblieben, von dem Segramors Fallen erfahren hatte, ohne freilich viel Gefallen dran zu finden. Parzivâl ritt, ohne weiter zu fragen, dahin, wo die Blutstränen lagen. Als er sie fand mit den Augen, da nahm die Liebe ihn sogleich wieder an ihre Leine. Und er sprach dazu kein Wort, weder so noch anders, denn er war schon wieder weit weg von der Vernunft.
Aus: Wolfram von Eschenbach: Parzival. Studienausgabe 2. Auflage. Mittelhochdeutscher Text nach der sechsten Ausgabe von Karl Lachmann. Übersetzung von Peter Knecht. Mit Einführungen zum Text der Lachmannschen Ausgabe und in Probleme der ‚Parzival‘-Interpretation von Bernd Schirok. Berlin/New York 2003, 282.23-289.3.
Im Mittelhochdeutschen sieht ein Teil der Blutstropfenszene wie folgt aus
do er die bluotes zäher sach
ûf dem snê (der was al wîz),
dô dâhter ‚wer hât sînen vlîz
gewant an dise varwe clâr?
Cundwierâmurs, sich mac für wâr
disiu varwe dir gelîchen,
mich wil got sælden rîchen,
Sît ich dir hie gelîchez vant.
gêret sî diu gotes hant
und al diu crêatiure sîn.
Condwir âmûrs, hie lît dîn schîn.
sît der snê dem bluote wîze bôt,
und ez den snê sus machet rôt,
Cundwir âmûrs,
dem glîchet sich dîn bêâ curs:
des enbistu niht erlâzen.‘
ίο des heldes ougen mâzen,
als ez dort was ergangen,
zwên zäher an ir wangen,
den dritten an ir kinne.
er pflac der wâren minne
gein ir gar âne wenken.
sus begunder sich verdenken,
unz daz er unversunnen hielt:
diu starke minne sîn dâ wielt,
sölhe nôt fuogt im sîn wîp.
dirre varwe truoc gelîchen lîp
von Pelrapeir diu künegin:
diu zuet im wizzenlîchen sin.
sus hielt er als er sliefe.
[…]
Sus fuor der unbescheiden helt
zuo dem der minne was verselt.
wedr em sluoc dô noch enstach,
ê er widersagen hin zim sprach,
unversunnen hielt dâ Pârzivâl.
ίο daz fuogten im diu bluotes mâl
und ouch diu strenge minne,
diu mir dicke nimt sinne
unt mir daz herze unsanfte regt.
[…]
Segramors sprach alsô
‚ir gebâret, hêrre, als ir sît vrô
daz hie ein künec mit volke ligt.
swie unhôhe iuch daz wigt,
ir müezt im drumbe wandel gebn,
odr ich verliuse mîn lebn.
ir sît ûf strît ze nâhe geriten.
doch wil ich iuch durch zuht biten,
ergebet iuch in mîne gewalt;
odr ir sît schier von mir bezalt,
daz iwer vallen rüert den snê.
sô tæt irz baz mit êren ê.‘
Parzivâl durch drô niht sprach:
frou minne im anders kumbers jach.
durch tjoste bringen warf sîn ors
von im der küene Segramors.
umbe wande ouch sich dez kastelân,
dâ Parzivâl der wol getân
unversunnen ûffe saz
sô daz erz bluot übermaz.
sîn sehen wart drab gêkeret:
des wart sîn prîs gemêret.
do er der zâher niht mêr sach,
frou witze im aber sinnes jach,
hie kom Segramors roys.
Parzivâl daz sper von Troys,
daz veste unt daz zæhe,
von värwen daz wæhe,
als erz vor der klûsen vant,
daz begunder senken mit der hant.
ein tjost enpfienger durch den schilt:
sîn tjost hin wider wart gezilt,
daz Segramors der werde degen
satel rûmens muose pflegen,
und daz dez sper doch ganz bestuont,
dâ von im wart gevelle kuont.
Parzivâl reit âne vrâgen
dâ die bluotes zäher lâgen,
do er die mit den ougen vant,
frou minne stricte in an ir bant.
Aus: Wolfram von Eschenbach: Parzival. Studienausgabe 2. Auflage. Mittelhochdeutscher Text nach der sechsten Ausgabe von Karl Lachmann. Übersetzung von Peter Knecht. Mit Einführungen zum Text der Lachmannschen Ausgabe und in Probleme der ‚Parzival‘-Interpretation von Bernd Schirok. Berlin/New York 2003, 282.23-289.3.
Einbindung der Blutstropfenszene aus Parzival in die Handlung
Es handelt sich bei der Blutstropfenszene aus Wolframs Parzival um eine Schlüsselszene, die Parzivals inneren Konflikt in einer poetischen und symbolischen Weise darstellt. Sie zeigt, wie sehr er noch in seiner weltlichen Liebe verhaftet ist und dass seine Reise auch eine innere Läuterung und Selbstüberwindung erfordert. Diese Szene passt perfekt in den Kontext der Parzival-Erzählung, da sie die Themen Liebe, Spiritualität und die Suche nach höherer Erkenntnis miteinander verwebt. Hier folgen einige lose Interpretationen. Es gibt zu der Szene viel Forschungsliteratur, gerade weil sie so bekannt ist.
Zwischen weltlicher und spiritueller Liebe
Die Szene steht exemplarisch für Parzivals Konflikt zwischen seiner Rolle als Ehemann und Ritter und seiner spirituellen Suche nach dem Gral. Sie zeigt, wie die weltliche Liebe ihn immer wieder zurückhält und gleichzeitig motiviert.
Parzivals Entwicklung
Die Blutstropfenszene markiert einen Moment der Reflexion und des Übergangs. Sie zeigt, dass Parzival noch nicht bereit ist, seine Aufgabe zu erfüllen, da er immer noch von weltlichen Emotionen beherrscht wird.
Thema der Ablenkung
Die Szene steht in starkem Kontrast zu der notwendigen Konzentration, die Parzival für die Gralssuche benötigt. Sein Verweilen bei den Blutstropfen zeigt, wie leicht der Mensch von äußerlichen Eindrücken und inneren Gefühlen abgelenkt werden kann.
Symbol des Grals
Die Blutstropfen können auch als Vorahnung des Grals interpretiert werden. Sie stehen für das Blut Christi und somit für die göttliche Erlösung, die Parzival sucht, auch wenn er dies in diesem Moment nicht erkennt.
Wichtige Figuren in Wolframs von Eschenbach Parzival
Es gibt im Parzival sehr viele Figuren, die alle unterschiedliche Funktionen haben. Die wichtigsten möchte ich hier aufführen, es gibt aber bereits sehr viele Figurenkataloge. Wie bereits in meinem Tür-Beitrag zu Alina Bronskys Pi mal Daumen erwähnt, kann Überzeichnung von Figuren ein Sichtbarmachen von zeitgenössischen Diskurse oder Ereignisse sowie gesellschaftlichen Problematiken verdeutlichen. Schon Wolfram nutzt die Technik der Übertreibung bei einigen Figuren, zum Beispiel bei Sigune.
Hauptfiguren in Wolframs Parzival
- Parzival
Der Held des Romans, der als »tumber Tor“»« beginnt und durch Abenteuer und spirituelle Einsicht zum Gralskönig reift. - Gahmuret
Parzivals Vater, ein ritterlicher Abenteurer, der auf der Suche nach Ruhm und Liebe stirbt, bevor Parzival geboren wird. - Herzeloyde
Parzivals Mutter, die ihn isoliert und fernab der Welt erzieht, um ihn vor dem gefährlichen Leben als Ritter zu schützen. - Cundwier âmûr
Parzivals Ehefrau, die für Liebe und Treue steht. Sie bleibt ihm trotz seiner langen Abwesenheit treu. - Anfortas
Der leidende Gralskönig, der aufgrund einer Sünde eine schwere Wunde trägt. Parzivals Mitgefühl und Frage sollen ihn erlösen. - Sigûne
Parzivals Cousine, die er auf seiner Reise mehrfach trifft. Sie leidet unter dem Tod ihres Geliebten und erstarrt in ihrer Trauer, während Parzival bei jedem Gespräch mit ihr wichtige Informationen erhält. - Feirefiz
Parzivals Halbbruder aus der Ehe von Gahmuret mit Belakane, als dieser im Kreuzzug unterwegs war. Er symbolisiert die Vereinigung von Christentum und Heidentum. Mit seiner Taufe und der Akzeptanz des Grals steht seine Figur für die Überwindung religiöser Differenzen und die universelle Gültigkeit des göttlichen Plans. Das lässt sich natürlich auch als mehr und weniger gewaltvolle Einverleibung ins Christentum bezeichnen.
Nebenfiguren in Wolframs Parzival (Auswahl)
- Gurnemanz
Ein weiser Ritter, der Parzival in höfischen Sitten und ritterlicher Tugend unterrichtet. Allerdings ist er auch dafür verantwortlich, dass Parzival bei seinem ersten Aufenthalt auf der Burg keine Frage an Anfortas richtet. - Orgelûse
Eine trauernde und rachsüchtige Herrscherin über ein verzaubertes Königreich, die Parzival zunächst verspottet, ihm aber später wichtige Lektionen über Mut und Mitgefühl gibt. - Cundrîe
Eine Gralsbotin mit animalischem Aussehen, die Parzival für sein Versagen tadelt, ihn später jedoch als neuen Gralskönig anerkennt. - Clâmidê
Ein Ritter, der Kondwiramur belagert. Parzival besiegt ihn und zeigt erstmals seine Fähigkeiten als Ritter. - Antanor
Ein Ritter, den Parzival in einem Duell verschont, was seine wachsende Menschlichkeit zeigt. - Keie
Ein Ritter der Tafelrunde, der oft spöttisch und provokant auftritt. Er steht im Kontrast zu Parzivals aufrichtiger Entwicklung. - Ithêr von Gaheviez
Der „rote Ritter“, den Parzival tötet, um an dessen Rüstung zu gelangen. Dieses Ereignis markiert den Beginn von Parzivals Heldenreise bzw. seiner Reise zur Erkenntnis auf dem Weg zum Gralskönig
Symbolische und mythologische Figuren
- Der Heilige Gral
Ein mystisches Gefäß, das göttliche Gnade und Fülle symbolisiert. Es ist der zentrale Gegenstand von Parzivals Suche. Er nährt die Auserwählten und verlangt nach einem moralisch reinen Hüter. - Belakâne
Feirefiz‘ Mutter und Gahmurets erste Frau, eine heidnische Königin. - Repanse de Schoye
Die Gralshüterin, die Parzivals Halbbruder Feirefiz heiratet. Sie verkörpert Reinheit und Gnade. - Die Figur des Anfortas:
Der leidende Gralskönig ist ein Bild für den gefallenen Menschen, der durch göttliche Gnade Erlösung finden kann. Parzivals Aufgabe ist es, durch Mitgefühl und die richtige Frage (Was fehlt dir?) Heilung zu bringen. - Der Einsiedler Trevrizent:
Trevrizent führt Parzival zu Reue und Gottvertrauen. Die Einsiedlerfigur repräsentiert die spirituelle Suche nach dem Sinn des Lebens.
Erweiterte Einordnung des Parzival in verschiedene Gattungen und Bereiche
Je nach Lesart lässt sich Parzival aufgrund der Themenvielfalt ein anderer Schwerpunkt finden, der gezielt mit der richtigen Methodik herausgearbeitet werden und einer eigenen literarischen Gattung zugeordnet werden kann. Parzival ist ein Abenteuerroman, ein spiritueller Bildungsroman, ein höfischer Entwicklungsroman oder aber einfach ein Werk über die Suche nach Erkenntnis und göttlicher Gnade. Die Figurenvielfalt und die zentrale Entwicklung Parzivals machen Wolframs Epos zu einem Meilenstein der mittelalterlichen Literatur. Ich finde, Wolframs Parzival kann je nach Perspektive in unterschiedliche Genres einsortiert werden. Einige davon liste ich hier auf:
Höfischer Roman
Parzival gehört zur höfischen Literatur, da es die Ideale des mittelalterlichen Rittertums (Ehre, Treue, Minne) und die höfischen Lebensweisen thematisiert.
Bildungsroman
Wolframs Werk beschreibt die Entwicklung des Helden von Naivität zu Weisheit und moralischer Reife. Parzival lernt aus seinen Fehlern und wächst durch Selbsterkenntnis.
Artusroman
Der Roman ist Teil des größeren Artus-Mythos, da die Tafelrunde und Artus selbst eine wichtige Rolle spielen. Parzival wird als Ritter in diese Welt eingeführt.
Gralsroman
Der Gral steht als christlich-mystisches Symbol im Zentrum der Handlung (auch wenn er nur – mit Hitchcocks Begrifflichkeit – ein MacGuffin ist, ein Element, das die wirklich wichtige Handlung vorantreibt). Die Suche nach dem Gral wird für Parzival zur spirituellen Reise, die Erlösung und Heilung bringt.
Mystischer Roman
Der Roman greift tiefgehende religiöse und metaphysische Fragen auf. Der Gral steht als Symbol für göttliche Gnade, und Parzivals Suche kann als spirituelle Pilgerfahrt interpretiert werden.
Theologischer Roman
Christliche Werte wie Reue, Gnade, Barmherzigkeit und die Suche nach Gott sind zentrale Themen. Der Gral und die Figuren wie Amfortas und Trevrizent verkörpern religiöse Konzepte.
Ritterroman/Aventiureroman
Abenteuer und ritterliche Prüfungen stehen im Mittelpunkt. Parzival muss Kämpfe bestehen, Freundschaften schließen und sich als würdiger Ritter beweisen.

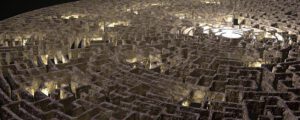


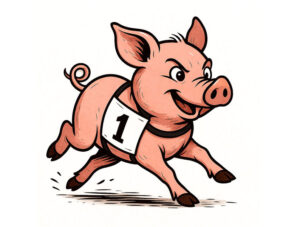
![Titelbild Koster, Henry: The Bishop’s Wife [Film]. Samuel Goldwyn Productions. United States 1947.](https://literarische-gedankenexperimente.de/wp-content/uploads/2025/03/Jede-Frau-braucht-einen-Engel-Screen-300x137.png)