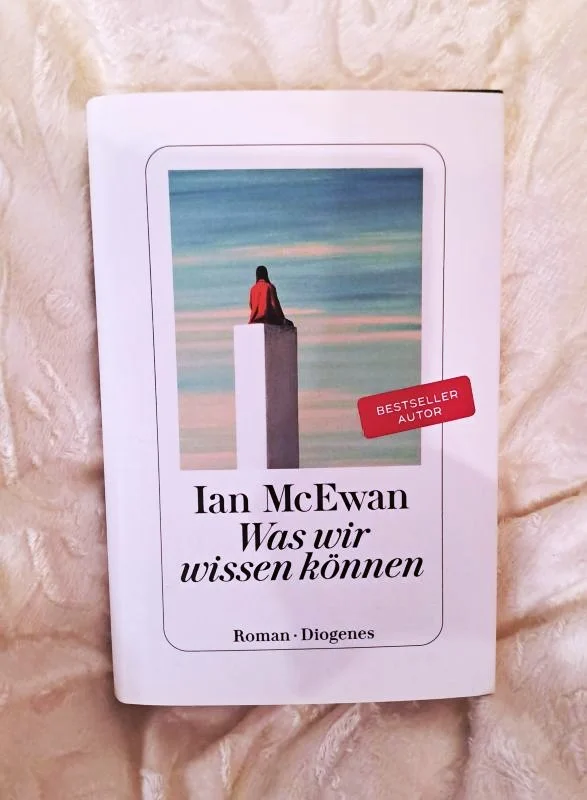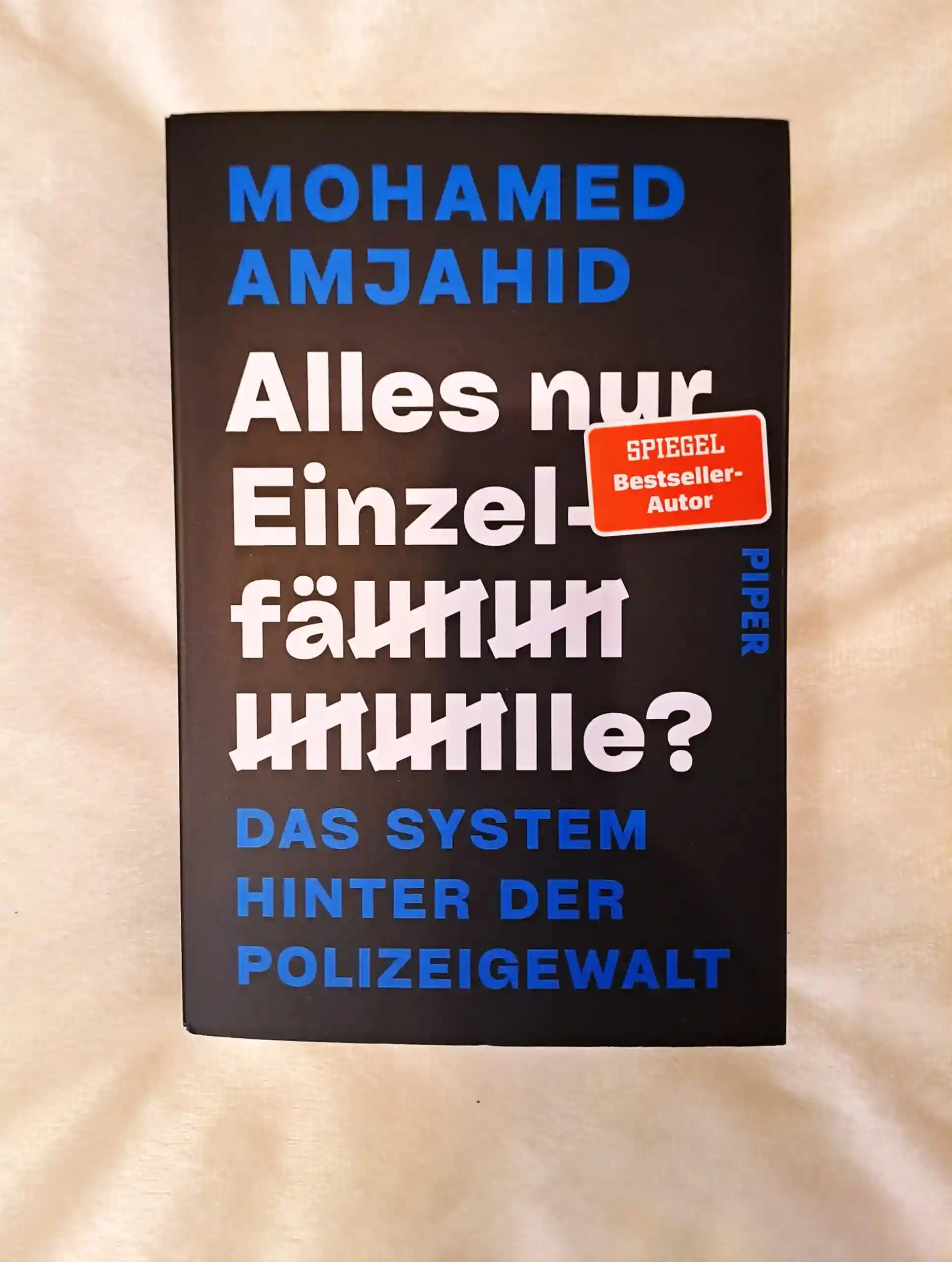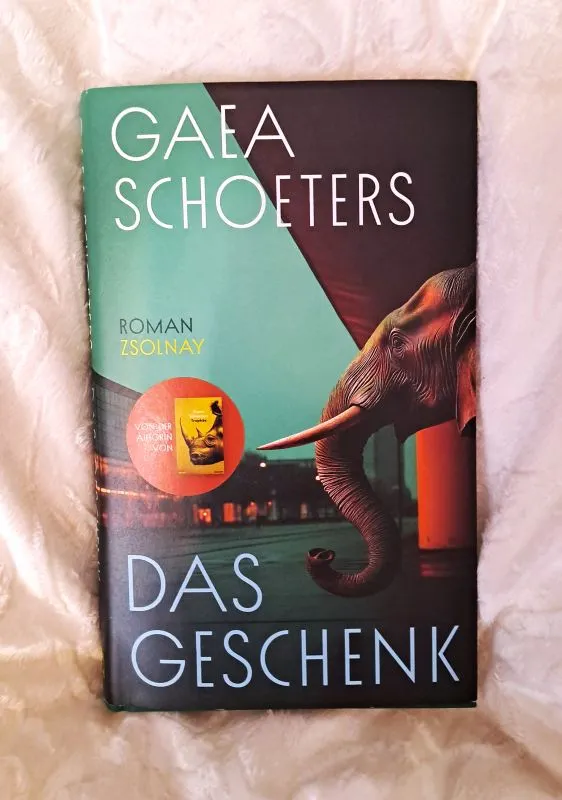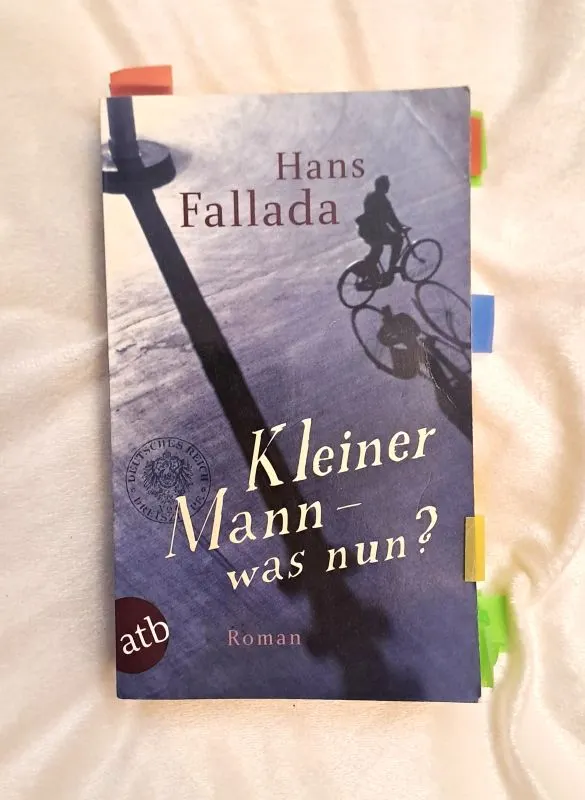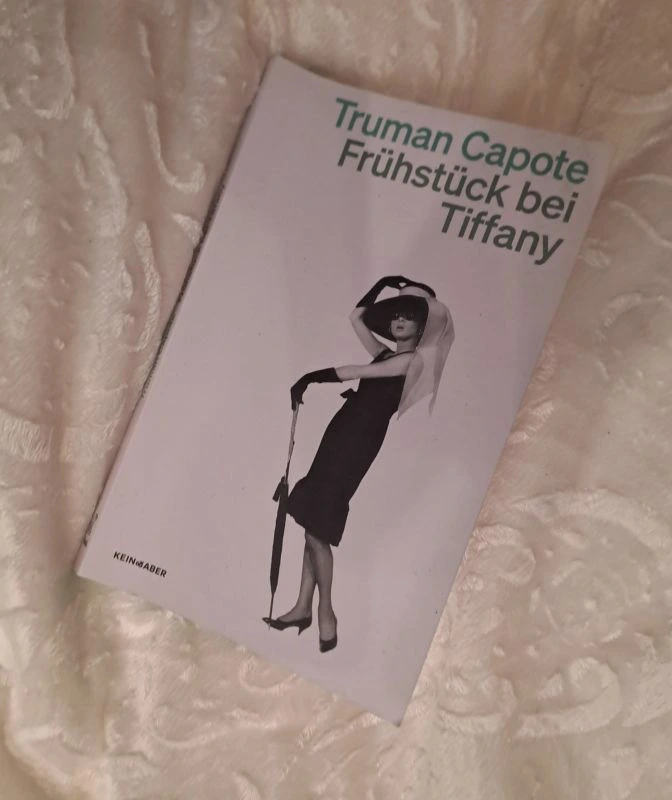Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025
Kollektive Verantwortung, gesellschaftliche Mitschuld, Schweigen und die NS-„Euthanasie“
In Die Welt da drinnen von Helga Schubert geht es um die erzählerische Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morden in der Schweriner Nervenklink. Das Buch kam mir dazwischen, denn ich habe gerade Halbinsel von Kristine Bilkau gelesen und wollte dazu etwas schreiben. Die Welt da drinnen erschien erstmals bereits 2003 und wurde 2021 in einer neuen Auflage veröffentlicht, auch weil Helga Schubert 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Bei Die Welt da drinnen handelt sich um ein auf realen Dokumenten basierendes literarisches Zeugnis, in dem die Schicksale einiger Patientinnen und Patienten der Schweriner Klinik während der Zeit des Nationalsozialismus erzählt werden, die im Rahmen der Euthanasiepolitik als „lebensunwert“ ermordet wurden. Schubert stützt sich auf Original-Akten, die nach der Wende 1990 ins Berliner Bundesarchiv gelangten. In akribischer und fürsorglicher Präzisionsarbeit schafft sie ein literarisches Werk, das auf reellen Daten fußt, doch keine objektive und historische Studie ist, sondern eine erzählerische Reflexion über Menschlichkeit, Moral und den Mechanismen hinter den Abgründen der Geschichte.
Zusammenfassung Die Welt da drinnen von Helga Schubert
Helga Schubert erzählt in Die Welt da drinnen sehr eindringlich davon, wie die Welt „drinnen“, also in psychiatrischen Einrichtungen, aussah – und wie Menschen dort in der NS-Zeit systematisch entrechtet, stigmatisiert und letztlich ermordet wurden – sie richtet den Blick aber auch von den Akten als letzte Zeugen auf die Menschen hinter den Notizen der Mediziner, richtet den Blick auf die Menschen, wie sie gewesen waren und gewesen sein könnten. Sie geht auch genauer auf die Titelfindung ein, das will ich hier aber nicht vorwegnehmen. Jedenfalls verknüpft Schubert Erinnerungsarbeit, persönliche Spurensuche und historische Rekonstruktion miteinander. Sie beleuchtet anhand der realen Akten Einzelschicksale und beschreibt die Mechanismen, die es ermöglichten, dass diese Morde geschehen konnten – etwa die Bürokratisierung der Tötungen und die Strukturen des Schweigens nach 1945. Das Buch ist sowohl ein Beitrag zur Gedenkkultur als auch eine kritische Reflexion darüber, wie über NS-„Euthanasie“ heute erzählt wird – und welche ethischen Fragen sich dabei stellen.
Über die Autorin Helga Schubert
Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, ist eine deutsche Schriftstellerin und Psychologin. Sie war in der DDR als Psychotherapeutin tätig und begann in den 1960er Jahren mit dem Schreiben. Ihre Werke umfassen Kinderbücher, Prosatexte, Theaterstücke und Hörspiele. Nach der deutschen Wiedervereinigung widmete sie sich verstärkt dokumentarischen Themen. In Judasfrauen geht es beispielsweise um Denunziantinnen im Dritten Reich. 2020 gewann sie mit ihrer Geschichte Vom Aufstehen den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis, was ihr eine breite Anerkennung einbrachte. Infolgedessen wurden alle ihre Bücher im dtv-Verlag neu aufgelegt. Seitdem hat sie sich darauf konzentriert, „kleine Kunstwerke“ zu schaffen, bei denen nichts dem Zufall überlassen wird. Ihr abgelegenes Zuhause in Mecklenburg dient ihr als Rückzugsort und kreativer Raum, in dem sie sich ganz dem Schreiben widmen kann.
Erzählte Erinnerung hat gesellschaftliche Dimensionen
Ich habe schon in vielen Beiträgen auf diesem Blog über den Akt des Schreibens und die zugrundeliegende Motivation dazu geschrieben. In Wir kommen lässt sich anhand des von 18 Autor*innen geführten Gesprächs nachvollziehen, dass Schreiben Aufarbeitung von Traumata ist, insofern also Erinnerungsarbeit. Das ist auch beim Protagonisten in Olga Martynovas Der Engelherd der Fall. In ihrem Beitrag zur Zeugenschaft im Rahmen der NS-„Euthanasie“unterscheidet die Kulturwissenschaftlerin Christel Dorothee Roer zwischen leidenschaftsloser Forschung und persönlicher Erinnerung.[1] Doch sieht sie beides für das Auffinden von historischer Wahrheit als bedeutsam an – die Verbindung von beiden Quellenarten. Eben dies ist beim Roman von Helga Schubert so effektiv, ist auch in vielen anderen Roman ein Thema, beispielsweise die autofiktionalen Werke Hasenprosa von Maren Kames oder Deniz Utlus Vaters Meer. Die sind hier nur genannt, um zu demonstrieren, dass dies nicht nur für historische Quellen und Erkenntnisgewinn gilt, sondern ein dem literarischen Schreiben auch zugrundeliegendes Prinzip sein kann und vielfach eben auch ist. Roer führt weiter aus: „Erinnerungen verweisen immer sowohl auf das heutige Leben mit der Vergangenheit wie auf das damalige Erleben selbst. Insofern ist Erinnerung Geschichte und zugleich etwas anderes: Biografie.“[2]
Und erzählte Erinnerung hat gesellschaftliche Dimensionen, sie wendet sich an Zuhörende:
„Erst durch das Gehörtwerden, durch das Bezeugen der Erinnerung durch den Zuhörer/ die Zuhörerin, wird sie real. Auf diese Weise schreibt sich das erinnernde Subjekt mit seiner biografischen Erzählung in das Geflecht sozialer Beziehungen ein. Nicht-Erzählen (-Können/ -Dürfen) heißt Nicht-Gehört-Werden, heißt Ausgrenzung aus Erinnerungsgemeinschaften, heißt soziale Ausgrenzung. „Der zweite Typ von Erinnerung, die „tiefe“, „visuelle“, „körperliche“, „unwillkürliche“ Erinnerung ist von einer Qualität, die sie die Betroffenen als extrem bedeutsam, aber auch extrem belastend erleben lässt.“[3]
Stumme Opfer, für die Partei ergriffen werden muss
Doch die Opfer der NS-„Euthanasie“ können sich nicht äußern, es ist auch niemand für sie eingetreten. Ich komme später noch diese Thematik zu sprechen. „Es gehörte und gehört sehr, sehr viel Mut dazu, Zivilcourage und Leidensfähigkeit, sich trotz alledem immer wieder zu Wort zu melden, eine Sprache zu finden und Bilder, um die Verbrechen der Psychiatrie zu erzählen, Geschichte werden zu lassen“ [4], so Roer. Eben dieser Mut ist Helga Schubert zuzusprechen, die jahrelang die Akten gesichtet und abgeschrieben hat, sich mit den Geschichten der Opfer, Täterinnen und Täter beschäftigt und alles für uns, die Leserinnen und Leser, die nachfolgenden Generationen festgehalten hat. „Ob wir ahnen, wie viel oft einsame Arbeit an eigener Scham und Angst damit verbunden ist? Wie schwer es ist, wenn die Zweifel kommen, ob die anderen doch Recht haben könnten? Wie schmerzhaft das Beharren auf dem Recht, respektiert und anerkannt zu werden, sich anfühlen kann? So gesehen verstehen wir nicht nur das Schweigen vieler Opfer, sondern wir nehmen es wahr als Teil der historischen Wahrheit.“[5] Auch Helga Schubert hat sich beim Schreiben entsprechende Fragen gestellt, gibt viele Fragen in Lesungen an Schulen weiter.[6] Ich kann an dieser Stelle nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie ich es gern würde, meine Ausarbeitung sprengt sonst den Rahmen. Darum will ich weitergehen und zunächst der Reihe nach das Thema vorstellen, dann Helga Schuberts Die Welt da drinnen einbinden und auch etwas zum zeitgenössischen Kontext, der Ermöglichung der Morde und zu der Architektur des Schweigens sagen sowie auch zum aktuellen Stand erschreckender Umfragewerte zum Sozialdarwinismus.
Schichten des Schweigens: Die NS-„Euthanasie“ als gesamtgesellschaftliches Versagen?
Als am 1. September 1939 Adolf Hitler rückdatiert die „Ermächtigung“ zur sogenannten „Euthanasie“ unterzeichnete, begann ein Verbrechen, das weit über die Grenzen medizinischer Institutionen hinausreichte. Die systematische Ermordung von über 200.000 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen wurde nicht allein von einer medizinischen Elite geplant und durchgeführt. Sie wurde ermöglicht durch ein komplexes Netzwerk aus Mittäterschaft, Mitwisserschaft und bewusstem Wegsehen, das vom Chefarzt bis zur Krankenschwester, vom Verwaltungsbeamten bis zum Busfahrer, von den Angehörigen bis zu den Nachbarn der Opfer reichte. Insofern kann man auch von einem vielschichtigen Gefüge der Kollektivschuld sprechen (da ist Karl Jaspers mit seiner Schuldfrage von 1946 ein interessantes Werk, Jaspers, Karl: Die Schuldfrage kann hier eingesehen werden), die sich nicht in der einfachen Dichotomie von Befehlsgeberinnen und -empfängerinnen erschöpft. Gefragt werden kann im Rahmen dieser Ausmaße auch nach dem Phänomen der Zivilcourage und ihrem systematischen Versagen angesichts staatlich organisierter und sich ausbreitender Unmenschlichkeit. Die NS-„Euthanasie“ offenbart eine tiefgreifende moralische Krise, die sich in der Frage der Kollektivschuld und dem Versagen des Gewissens manifestiert.[7] Viele Menschen schwiegen oder unterstützten die Verbrechen durch ihr Passivsein, sei es aus Angst, Gleichgültigkeit oder ideologischer Überzeugung. Dieses Schweigen und die fehlende moralische Opposition ermöglichten die systematische Ermordung von Menschen, die als „lebensunwert“ bezeichnet wurden. Dieses Versagen des Gewissens (hier kann man auch wieder Jaspers anführen) zeigt sich in der Bereitschaft, staatliche Autorität(en) und pseudowissenschaftliche Rechtfertigungen über grundlegende ethische Prinzipien zu stellen. Die NS-Propaganda entmenschlichte die Opfer und schuf eine Atmosphäre, in der moralische Verantwortung verdrängt wurde, ebenso wie die Schuldfrage, was die gesellschaftliche Aufarbeitung erschwerte. Die Diskussion über Kollektivschuld und individuelles Versagen bleibt bis heute relevant, da sie die Bedeutung von Zivilcourage und ethischem Handeln in einer Gesellschaft unterstreicht.
Ein Auftrag – Funktionsweisen der Diktatur diskutieren
Helga Schubertwurde auch von Schulen eingeladen und diskutiert dort über die Funktionsweise der Diktatur. Am Ende von Die Welt da Drinnen befindet sich ein exemplarisches Gespräch zu solch einem Schulbesuch. Man kann sich die Szene vorstellen: Lauter Teenager sitzen mitten im Sommer in einem Klassenzimmer und hätten sich vielleicht eine angenehme Zeit mit diesem Gast, dieser Autorin erhofft, doch beginnt sie mit dieser Anweisung:
Adolf Hitler
Berlin, den 1. September 1939
Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann.
Aus: Schubert, Helga: Die Welt da drinnen“. Eine deutsche Nervenklinik und der Wahn vom unwerten Leben. Mit einem Vorwort der Autorin. München 2021, hier S. 258.Und dann stellt die Autorin folgende afrage an die Schülerinnen und Schüler:
„Stellen Sie sich vor, es ist September 1939, und jeder von Ihnen hieße entweder Philipp Bouhler oder Dr. med. Karl-Heinz Brandt. Sie wären also entweder Reichsleiter in der Kanzlei des Führers oder der Leibarzt Hitlers. Wie würden Sie den Erlass Ihres Führers und Reichskanzlers über den Gnadentod denn nun umsetzen?
Aus: Schubert: Die Welt da drinnen“, S. 257.
Wie eine Diskussion über NS-„Euthanasie“ einleiten?
Die Diskussion, die sich aus dieser Einführung entspinnt, ist hochinteressant und demonstriert erschreckend, welche Schlussfolgerungen sich angesichts eines solchen Auftrags entfalten. In einem Interview äußerte sich Helga Schubert zu dieser, in Die Welt da drinnen festgehaltenen, Erfahrung.
Aus diesem Grund habe ich Lesungen an Schulen gemacht, als das Buch noch nicht fertig war. Von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wurde ich öfter in Gymnasien eingeladen. Da habe ich das gemacht, was ich im letzten Kapitel meines Buches beschreibe. Es ist mir sehr wichtig, das Thema in die Gegenwart zu holen. Ich habe den Schülern gesagt, sie sollen sich nicht in die Opfer oder in die Angehörigen hineinversetzen, sondern in die potenziellen Täter, die ehrgeizig und tüchtig sind. Sie sollten sich vorstellen, in einer Behörde in Berlin zu arbeiten und die Aufgabe zu bekommen, lebensunwertes Leben zu vernichten. Sie antworten alle, dass sie das nie machen würden. Nach zwei Stunden Diskussion sagten sie: Durch die Arbeitsteilung der Ermordung die Ausgrenzung, das Ausfüllen der Meldezettel und alles weiter kann man immer sagen, dass man das nicht gemacht hat. Im Grunde genommen kann dort jeder gesessen haben. Das ist eine bittere Schussfolgerung, die die Schüler sehr berührt hat. Die haben alle am Anfang gesagt: Nein, das würde ich nie machen. Wenn man sich dann aber näher mit der Diktatur beschäftigt, dann kriegt man dieses Verführerische mit. Es muss darum gehen, genau das zu verhindern. Ich habe dieses Gedankenexperiment ganz oft gemacht und ich glaube, dass ich viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich zum Nachdenken gebracht habe.“
Aus: „Die Welt da drinnen“. Im Gespräch mit Helga Schubert. In: Verdrängt. Die Erinnerung an die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde. Herausgegeben vom Bezirk Oberbayern durch das Zentrum Erinnerungskultur der Universität Regensburg (Jörg Skriebeleit und Winfried Helm). Göttingen 2023, S. 222-231, hier S. 228.
Verführung, Ehrgeiz, Gehirnwäsche und Gemeinschaft
Tatsächlich habe ich über dieses Verführerische, dieses sich einschmeichelnde und langsam dem Bewusstsein überstülpende Ermächtigende bereits konkreter in meinem Essay über Thomas Manns Mario und der Zauberer geschrieben. Es geht dort um Hypnose und Gehirnwäsche, um Vereinnahmung und Manipulation, um Propaganda und Willensfreiheit. Zauberei ist Kunst und Augenwischerei – das wird an der Figur des Zauberers Cipolla in Mario und der Zauberer sehr gut inszeniert – überhaupt ist dieser Begriff der Inszenierung, des In-Szene-Setzens exemplarisch für den Nationalsozialismus und die Propagandamaschinerie, die ausgefeilter nicht hätte sein können. Insofern gehört das Mutternarrativ, wie es an der Märtyrerfigur Horst Wessel und dem gleichnamigen Roman „inszeniert wurde“ mit zu diesem Ungetüm des nationalsozialistischen „Marketings“, um hier einfach einen modernen Begriff zu verwenden. Ich kann die Novelle von Thomas Mann weiterempfehlen, sie ist gerade zu dieser Zeit hochinteressant. Doch ich möchte auf das Verführerische der Diktatur zurückkommen und zu Helga Schuberts Unterrichtsstunde. Mittlerweile ist man bei der Ausstellung der Briefe mit der Todesnachricht für die Angehörigen angelangt – wer soll diese ausstellen, sodass nicht auffällt, dass die „nutzlosen Esser“ ermordet und nicht an der dort angegebenen Todesursache gestorben waren.
Vielleicht sollte in jedem Krankenhaus nur ein Arzt diese Todesbenachrichtigungen schreiben. Nämlich der, dessen Befugnisse wir erweitert haben, der Arzt unseres Vertrauens sozusagen.
Das bedeutet aber auch, dass wir in jedem Krankenhaus einen solchen Arzt finden müssen, auf den wir uns absolut verlassen können.
Was müsste der für Eigenschaften haben?
Er müsste eine höhere Stellung haben, oder wir müssten für eine baldige Beförderung sorgen. Er kann schließlich nicht ein einfacher Assistenzarzt sein. Der hätte ja in der Klinik nicht viel zu sagen und könnte seinen Mitarbeitern nicht einfach Stillschweigen befehlen oder mit Nachteilen drohen.
Mit welchen Nachteilen könnte er denn drohen?
Wenn Sie nicht machen, was ich sage, kommen Sie ins KZ.
Wenn Sie nicht schweigen, melde ich Sie dem Geheimdienst. Ein solcher Arzt hab viele Mitwisser.
Ja, wenn er nicht selbst Direktor der Klinik ist, dann ist auch sein Vorgesetzter Mitwisser. Der muss das decken nach außen und nach innen.
Was könnte der Direkter einer Nervenklinik für Gründe haben, Morde an seinen Patienten zu decken?
Er könnte aus seiner eigenen Überzeugung heraus die Morde nicht als Morde ansehen, sondern als notwendige Tötungen. Er könnte also grundsätzlich einverstanden sein.
Oder aus irgendeinem Grund erpressbar sein und darum schweigen.
Warum?
Es könnte Fehler in seinem Beruf gemacht haben, die nicht herauskommen dürfen. Er könnte Angst haben, seine Stelle zu verlieren und zurückgestuft zu werden, vielleicht seine bequeme Dienstwohnung zu verlieren, sein hohes Gehalt, seinen guten Ruf in der Stadt. Seine Pension.
Aus: Schubert: Die Welt da drinnen, S. 277-278.
Das hört sich nach Verschwörungstheorien an, könnte man denken? Nun, das sind Methoden, um Menschen bei der Stange zu halten und alles nach außen hin ordentlich darzustellen. Ich habe das selbst erlebt, die Mechanismen zuerst nicht deuten können, weil ich noch Vertrauen in die Menschen im System hatte. Ich hätte aber spätestens hellhörig werden können, als ich am Kopierer ein Gespräch mithörte (die Tür war offen) und den Kolleginnen und Kollegen eingeschärft wurde, ja nichts nach außen dringen zu lassen. Ich habe schon genug gesehen, als dass ich zu naiv wäre, daran zu glauben, dass die Mechanismen des NS-Systems heute nicht mehr greifen würden.
Wie also kann sich ein Individuum in einem kranken System behaupten?
Nein, nicht nur behaupten, sondern dafür sorgen, dass diskriminierende und machtpolitisch gesteuerte Mechanismen ausgehebelt werden für ein menschlicheres Miteinander? In diesem Sinne ist die Auseinandersetzung mit den der NS-„Euthanasie“ zuträglichen Systemen für mich nicht nur theoretischer Natur, sondern auch persönlich. Darum ist die Auseinandersetzung mit literarischen und philosophischen Themen über Diskriminierung, Ausgrenzung, Mobbing, Gewalt und Gruppendynamiken so wichtig für mich geworden. Aus diesem Grund verbinde ich theoretische Texte mit Literatur, Filmen, Kunstobjekten und mit meiner eigenen Erfahrung – wahrscheinlich auch, um selbst neue Erkenntnisse über das Wesen dieser Begriffe zu erfahren, die in der realen Welt vom Wort zu Handlungen werden und leider real sind. Und dazu gehört eben auch die Auseinandersetzung mit der Ermordung von Menschen im Rahmen der NS-„Euthanasie“. Das ist kein schönes Thema, es ist kein angenehmes Thema, man kann es sich nicht geradereden. Ich sehe heute viele der Mechanismen, die das Schweigen damals ermöglichten auch heute noch an vielen Orten. Es geht zum Beispiel um Autoritätshörigkeit und um Schweigen, Zugehörigkeit und natürlich Macht. Warum? Aus denselben Gründen, die in Die Welt da drinnen diskutiert werden – Erpressbar sein, Angst um das Gehalt, Verschweigen eigener Verfehlungen usw. Neinsagen kann sich wohl niemand leisten, der hoch hinauswill.
Gewalt kann nie sauber sein, Gewalt ist blutig
In Die Stunde der Spezialisten von Barbara Zoeke, einem Roman von 2017, geht es ebenfalls um Opfer und Täterinnen und Täter der NS-„Euthanasie“. Dort heißt es:
Gewalt kann nie sauber sein, Gewalt ist blutig. Sie entblößt die Opfer. Stinkende, schmutzstarrende Tiere. Daher der Zauber der technischen Rituale, des gleitenden Ineinanders von Handgriffen, der Konspiration, ja Verschwörung. Stillschweigend verpflichteten wir einander zum Stillschweigen. Nur über technische Mängel wurde gesprochen. Sie waren zu beseitigen, so schnell wie möglich, so sachlich wie möglich. Und was Gewalt mit den Tätern macht, wird sich später zeigen.
Viel später.
Aus: Zoeke, Barbara: Die Stunde der Spezialisten. Berlin 2017, S. 176.
Wie wird man Komplizin oder Komplize eines Unrechtssystems?
Es ist interessant, dass ich hier die literarischen Aussagen der Schülerinnen und Schüler im Gespräch mit Helga Schubert in Die Welt da drinnen mit Barbara Zoekes Die Stunde der Spezialisten verbinden kann. Die Stunde der Spezialisten wurde 2017 veröffentlicht und leistet einen wichtigen Beitrag zur literarischen Aufarbeitung der NS-Medizinverbrechen und beleuchtet besonders die persönliche und moralische Dimension der Verstrickung von Medizinern in das NS-„Euthanasie“-Programm. Schrittweise wird die Erosion ethischer Grenzen narrativ erörtert und gezeigt, wie auch gebildete, „zivilisierte“ Menschen zu Komplizen eines Unrechtssystems werden können. Und weil sich deutliche Überlappungen zeigen und auch Barabara Zoeke Fakten in ihren Text einwebt, auf andere Weise als Helga Schubert zwar, doch sind sie auch vorhanden, möchte ich hier Verbindungen aufzeigen.
Barbara Zoeke und Die Stunde der Spezialisten
Barbara Zoekes Die Stunde der Spezialisten gibt sowohl den Opfern als auch den Täterinnen und Tätern der NS-„Euthanasie“ eine Stimme. Die Geschichte dreht sich um Max Koenig, Professor für Altertumswissenschaften, dessen Leben durch die Diagnose einer erblichen neurologischen Krankheit aus der Bahn geworfen wird. Huntington – ein quälender Tod wird ihm vorhergesagt. Diese Diagnose zwingt ihn dazu, seine Karriere, seine italienische Frau und ihre gemeinsame Tochter hinter sich zu lassen. Trotz seiner Stellung als Professor und seinen Leistungen gehört er zu denen, die aussortiert und auf Meldebögen vermerkt werden. Die von mir ausgewählte Szene zeigt nun, wie Koenig im Bett liegt, reden kann er nicht mehr und bewegen geht auch schlecht. Aber er ist wach im Geiste – man stelle sich Stephen Hawking vor, dessen Geist trotz seines verfallenen Körpers hellwach war. Die Gedankengänge sind also für uns Leserinnen und Leser sichtbar und auch die Gespräche der Ärzte bekommt Koenig mit, kann sich aber dazu aufgrund seines Zustands nicht äußern.
„Also setzen wir ihn [gemeint ist Professor Koenig] auf die Liste, hörte ich den Stationsarzt beim Hinausgehen sagen.
Zunächst füllen wir den Meldebogen aus, der auf der Station liegt, korrigierte der Chef. Wir wollen doch die vorgeschriebene Reihenfolge einhalten, Herr Kollege. Übrigens werde ich Ihre therapeutischen Bemühungen gesondert erwähnen. Sie könnten die vergleichende Untersuchung der Insulintherapie für Ihre Karriere nutzen: Insulinschocks bei Schizophrenie, bei Depressionen, bei fortschreitenden Muskelerkrankungen. Könnte für Ihr Fortkommen sehr wichtig werden.“
Aus: Zoeke, Barbara: Die Stunde der Spezialisten. Berlin 2017, S. 69.
Die Perspektive der Täterinnen und Täter
Ich bleibe noch kurz bei Die Stunde der Spezialisten, denn im Roman wird die andere Perspektive gezeigt, wie sie ja gerade angeklungen ist, hier durch den Chefarzt Dr. Lerbe:
„Schließlich kamen alle weiter, die Bereitschaft zur Mitarbeit signalisierten. Erst gaben sie mit dem Parteibuch an, dann mit ihren neuen Titeln. Amtsarzt. Betriebsarzt. Ärzteführer.
Aus: Zoeke: Die Stunde der Spezialisten, S. 150.
Dazu gibt es natürlich Aussichten auf bessere Lebensbedingungen, Karrierechancen und Schutz vor dem Kriegsdienst wie das folgende Gespräch zeigt:
Vorerst werde ich wohl nicht eingezogen. Betriebsarzt und Arzt in einem Lungensanatorium: kriegswichtig genug. Außerdem hat Dr. Conti, der neue Reichsgesundheitsführer, vorige Woche angedeutet, dass besondere Aufgaben auf mich warten. Streng geheime Reichssache. Ich war bei ihm im Hauptamt für Volksgesundheit. Sehr noble Villa, mit Blick auf den Wannsee und gepflegtem Grün vor den Fenstern.
Arisiert, wie viele Häuser da draußen.
Die Juden haben in Deutschland lange genug die besten Plätze besetzt, sagte Dr. Conti zu mir. Jetzt sind wir an der Reihe. Und wir werden alles, was wir mit hohem Einsatz erreicht haben, zu verteidigen wissen.
Aus: Zoeke: Die Stunde der Spezialisten, S. 151.
Zum geheimen Helden werden in der Diktatur
Helga Schubert hat bei ihren Recherchen zu Die Welt da drinnen viele Akten gelesen und abgeschrieben, viel Zeit investiert in eine Tätigkeit, die einen ungefilterten Blick auf die aus einer Diktatur erwachsenden Handlungsweisen zulässt. So ist Alfred L. ein Täter, ein Arzt, der gemordet hat und doch freikam. Wie kann das sein? Etwa 100 Menschen habe er ermordet, gab er vor Gericht zu, dabei hätten es doch 180 sein sollen, gab er als Entschuldigung an. (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 209). „Er seit als Retter dieser nicht ermordeten Menschen anzusehen und hätte die 100 nur getötet, um die Nichtermordung der anderen zu tarnen.“ (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 209). Da diesem Arzt, auf dessen Anweisung Schwestern und Pfleger gemordet hatten, die Flucht gelang, stand er zunächst nicht vor Gericht. (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 215) Erst 1953 kam er wegen der Beteiligung an der NS-Euthanasie wieder vor Gericht und wurde „von der Anklage der Beihilfe zum Todschlag mangels Beweises frei[gesprochen].“ (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 215) Er hatte angegeben, eigentlich Gegner der Euthanasie zu sein, das konnte die Richter nicht widerlegen. (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 215).
„Er habe sich an der Aktion nur beteiligt, um selbst die Kontrolle über die Patiententötungen zu behalten, sagte Dr. Alfred L. Er wollte so gewährleisten, dass nur menschliche Hülsen (so ohne Anführungsstriche, stand es im Kölner Urteil) und unter der Tierstufe vegetierende Wesen (auch dies stand so im Urteil) vernichtet wurden. Durch seine Auswahl und seine Anweisungen seien viele weniger schwer geschädigte Kinder und Erwachsene am Leben geblieben, die sonst der Euthanasie zum Opfer gefallen wären.“
Aus: Schubert: Die Welt da drinnen, S. 216
Das ist nicht alles, es geht weiter in der Argumentation des Arztes, die im Kapitel „Ein geheimer Gegner der Euthanasie“ anführt. Er habe die Tötung der Kinder sabotieren wollen, nicht gewusst, wofür die Meldezettel gewesen seien und so weiter. Es gab Gegenaussagen von drei anderen Ärzten, denen das Gericht nur begrenzt Glauben schenkte. (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 219-220). Ich empfehle die Lektüre von Die Welt da drinnen, um sich einen direkten Eindruck machen zu können.
Auch in Die Stunde der Spezialisten taucht der Begriff „Held“ an mehrfachen Stellen auch, so auch hier, wenn Dr. Lerbe sein Heldentum am undenkbaren Tun (er meint natürlich die Morde) festmacht und bei dieser Aussage auch Größenwahn mitschwingt:
An fromme Sprüche sollen andere glauben; ich habe die Wissenschaft gewählt, die Wissenschaft von der Rasse. Und was wir jetzt tun, das Undenkbare, das wollen wir in unser Ich gar nicht aufnehmen. Wir werden nicht darüber sprechen. Dann ist es nicht geschehen. Wir werden das Undenkbare tun und trotzdem Helden sein. Stille Helden.
Aus: Zoeke: Die Stunde der Spezialisten, S. 167-168.
Den Mord rechtfertigen – Das Gewissen Schachmatt setzen
Die renommierte US-Historikerin Dagmar Herzog hat mit Eugenische Phantasmen eine großangelegte Untersuchung der Geistesgeschichte der geistigen Beeinträchtigung in Deutschland geschaffen. Das Werk beleuchtet die Debatten über den Wert des Lebens von Menschen mit Behinderungen, die sich über die letzten 150 Jahre erstrecken. Herzog zeichnet die Vorgeschichte und Nachwirkungen der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde nach und zeigt, wie zäh der Prozess des „Verlernens“ der Eugenik in Deutschland war und ist. Sie selbst erklärt dazu:
In diesem Buch untersuche ich also die Entwicklung historischer Debatten über den Wert des Lebens behinderter Menschen. Eines meiner Schlüsselargumente ist, dass dieses Thema für die Geschichte der Medizin und Psychiatrie, der Theologie und Religion, der Wohlfahrt und Pädagogik, aber auch für die des Kapitalismus und der Arbeit sowie der Sexualität und Fortpflanzung relevant ist. Jedes Kapitel zeichnet weniger einen Paradigmenwechsel als vielmehr einen Paradigmenkampf nach: einen Konflikt über den Interpretationsrahmen für Fakten und die aus solchen Interpretationen zu ziehenden Konsequenzen. Indem sie darüber stritten, wie sie über ihre Mitmenschen mit einer großen Bandbreite geistiger Behinderungen und psychischer Erkrankungen denken, was sie ihnen gegenüber empfinden und welchen Umgang mit ihnen sie an den Tag legen sollten, arbeiteten die Deutschen in den letzten eineinhalb Jahrhunderten sehr viel über ihr Selbstverständnis als Nation heraus.[8]
Aber das Interessante ist, dass ich Herzogs Studie heranziehen kann, um die Rechtfertigung des Arztes aus Helga Schuberts Die Welt da drinnen zu erklären. Genaueres ist im Kapital „Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Tat zu finden“:
Nach einer kurzen anfänglichen Welle von Verurteilungen von Ärzt:innen und Krankenpfleger:innen wegen Beihilfe oder Beteiligung an den Morden waren die folgenden Jahre geprägt von eingestellten Verfahren, Freisprüchen, Amnestien und allgemeinerer Exkulpation. Man entwickelte verschiedene Rechtfertigungen, um die Mörder zu entlasten. Drei sind besonders signifikant. Da war zunächst die Vorstellung der »Pflichtenkollision«, besser bekannt in der umgangssprachlichen Formulierung »um Schlimmeres zu verhindern«, also: manche zu töten, um andere zu retten. Ein zweiter Schachzug war das deutsche Rechtskonzept »Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Tat«. Wenn die grundlegende Selbstverteidigung im Hinblick auf die Ermordung von Juden lautete: »Ich habe lediglich Befehle befolgt«, so war die Grundbehauptung in Bezug auf die »Euthanasie«-Morde: »Ich dachte, es sei legal.« Ein drittes Argument war, dass Binding und Hoche schlicht Recht hatten.[9]
Binding und Hoche über die Freigabe der Vernichtung „lebensunwerten“ Lebens
Karl Binding, ein Jurist und Professor für Strafrecht in Leipzig, und Alfred Hoche, ein Psychiater und Professor in Freiburg, veröffentlichten 1920 das Buch Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Darin argumentierten sie, dass bestimmte Menschenleben – etwa das von schwer kranken oder geistig behinderten Personen – als „lebensunwert“ angesehen und deren Tötung legitimiert werden könne. Darin vertraten sie die These, dass das Leben schwerkranker und geistig behinderter Menschen nicht denselben Wert besitze wie das von gesunden Individuen, und sprachen sich für eine Legalisierung der Tötung sogenannter „Ballastexistenzen“ aus. Nach einigen deutlichen Passagen aus dem Werk werde ich anschließend eine Brücke ins Jetzt schlagen.
Die in Betracht kommenden Menschen zerfallen nun, soweit ich zu sehen vermag, in zwei große Gruppen, zwischen welche sich eine Mittelgruppe einschiebt. In
1. die zufolge Krankheit oder Verwundung unrettbar Verlorenen, die im vollen Verständnis ihrer Lage den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen und ihn in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben haben?
[…]
2. Die zweite Gruppe besteht aus den unheilbar Blödsinnigen — einerlei ob sie so geboren oder etwa wie die Paralytiker im letzten Stadium ihres Leidens so geworden sind. Sie haben weder den Willen zu leben, noch zu sterben. So gibt es ihrerseits keine beachtliche Einwilligung in die Tötung, andererseits stößt diese auf keinen Lebenswillen, der gebrochen werden müßte. Ihr Leben ist absolut zwecklos, aber sie empfinden es nicht als unerträglich. Für ihre Angehörigen wie für die Gesellschaft bilden sie eine furchtbar schwere Belastung. Ihr Tod reist nicht die geringste Lücke — außer vielleicht im Gefühl der Mutter oder der treuen Pflegerin. Da sie großer pflege bedürfen, geben sie Anlaß, daß ein Menschenberuf entsteht, der darin aufgeht, absolut lebensunwertes Leben für Jahre und Jahrzehnte zu fristen.
[…]
Wieder finde ich weder vorn rechtlichen, noch vom sozialen, noch vom sittlichen, noch vom religiösen Standpunkt ans schlechterdings keinen Grund, die Tötung dieser Menschen, die das furchtbare Gegenbild echter Menschen bilden und fast in Jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet, freizugeben — […][10]
Das Buch, das ursprünglich in akademischen Kreisen diskutiert wurde und als theoretischer Diskussionsbeitrag gedacht war, wurde in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten aufgegriffen und zur pseudowissenschaftlichen Rechtfertigung der sogenannten „Euthanasie“-Programme genutzt. Binding starb kurz nach der Veröffentlichung und konnte somit die spätere politische Instrumentalisierung seiner Ideen nicht mehr miterleben. Hoche hingegen distanzierte sich später teilweise von den radikalsten Interpretationen seines Beitrags, blieb aber bei der Grundannahme, dass es Leben geben könne, das „wertlos“ sei.
Wertes und unwertes Leben – Begriffe mit Verfallsdatum oder aktuell?
Ich bin schon vor einiger Zeit auf Umfragen gestoßen, die mich persönlich erschreckt haben.
Laut einer im Jahr 2024 in Deutschland durchgeführten Umfrage von Statista stimmten insgesamt 9,4 Prozent der Befragten der Aussage „Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen“ zu.[11] Der Aussage „Es gibt wertvolles und unwertes Leben“ stimmten nur 2,5 Prozent der Befragten zu 6,4 stimmten überwiegend zu, 10,5 Prozent waren geteilter Ansicht und mehr als 50 Prozent lehnten die Aussage überwiegend oder völlig ab. Damit war dies die als sozialdarwinistisch eingestufte Aussage mit der höchsten Zustimmung. In diesem Zusammenhang sind auch die Ergebnisse einer Studie von infratest dimap im Auftrag der ARD von 2023 zum Vergleich interessant.
![Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen [zum Sozialdarwinismus] zu? Veröffentlicht vom Statista Research Department am 14.11.2024, Quelle Uni Leipzig, online unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/562634/umfrage/umfrage-zum-sozialdarwinismus-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen am 24.04.2025).](https://literarische-gedankenexperimente.de/wp-content/uploads/2025/04/Umfrage-Sozialdarwinismus.png)
Zur Umfrage Rechtsextreme Positionen finden Anklang bei AfD-Wähler:innen schreibt René Bocksch: „Zu der sozialdarwinistischen Auffassung von “wertvollem und unwertem Leben” wie sie im Nationalsozialismus existierte, bekennt sich rund ein Drittel der befragten AfD-Wähler:innen. Ebenfalls ein Drittel will auch gute Seiten an der NS-Zeit sehen. 39 Prozent würden eine Diktatur auch heute noch befürworten.“[12]

Wie sind diese Umfrageergebnisse zu bewerten?
Die Aussage „Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen“ ist eindeutig eine sozialdarwinistische Idee. Sozialdarwinismus ist eine pseudowissenschaftliche Ideologie, die Darwins Evolutionstheorie missbraucht, indem sie das Prinzip vom „Überleben des Stärkeren“ auf menschliche Gesellschaften überträgt, um soziale Ungleichheit, Rassismus und die Ablehnung von Sozialpolitik als „natürlich“ zu rechtfertigen. Behauptet wird dann, dass Stärke, Macht oder Überlegenheit natürliche und wünschenswerte gesellschaftliche Prinzipien seien.
Im Nationalsozialismus war diese Denkweise zentral
Wenn heute 9,4 % der Deutschen einer Aussage „Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen zustimmen, ist das alarmierend, weil:
- Sozialdarwinistisches Denken historisch direkt mit faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien verbunden ist.
- Solche Einstellungen zentrale demokratische Werte wie Menschenwürde, Solidarität und Rechtsgleichheit untergraben.
- Gerade in Deutschland mit seiner Geschichte die Wiederkehr solcher Gedanken ein Warnsignal für gesellschaftliche Radikalisierungstendenzen ist.
Es bedeutet nicht automatisch, dass alle 9,4 % bewusste Nationalsozialisten sind — aber:
- Es zeigt, dass Ideen von Überlegenheit, Stärke als Rechtfertigung für soziale Dominanz und Entsolidarisierung in Teilen der Gesellschaft wieder Anschlussfähigkeit gewinnen.
- Diese Zustimmung sollte sehr ernst genommen werden, vor allem in politischen, pädagogischen und öffentlichen Diskursen.
Die aktuellen Studien zeigen also, dass zentrale Elemente der NS-Ideologie – Sozialdarwinismus, Nationalismus, Elitarismus und autoritäres Denken – nicht historisch überwunden sind.
Gesellschaftliche Verdrängung, fehlende Auseinandersetzung und neue politische Kräfte tragen dazu bei, dass alte Denkstrukturen wieder Anschlussfähigkeit gewinnen. Aus dem Grund hatte ich mich auch mit Mario und der Zauberer von Thomas Mann beschäftigt – dort werden die solch eine Ideologie ermöglichenden Mechanismen narrativ inszeniert. Und so etwas darf nicht wieder passieren.
Ableismus – Vorurteile heute
Das Wort mag vielleicht noch nicht überall geläufig sein, doch möchte ich kurz eine weitere Brücke schlagen, zunächst mit einer Definition des Begriffs von der Aktion Mensch:
„Werden Menschen im Alltag auf ihre körperliche, ihre psychische Behinderung oder zum Beispiel auf eine Lernschwierigkeit reduziert und ungleich behandelt, spricht man in der Fachsprache von Ableismus. Genauer bedeutet Ableismus also, dass Menschen mit Behinderung von anderen Menschen ohne Behinderung auf die Merkmale reduziert werden, in denen sie sich vom vermeintlichen Normalzustand unterscheiden. Dies können zum Beispiel sichtbare oder unsichtbare Merkmale sein, also ein Rollstuhl oder eine psychische Erkrankung. Von diesen Merkmalen wird anschließend, ohne die Person mit Behinderung zu kennen oder mit ihr zu sprechen, beispielsweise darauf geschlossen, was die Person vermeintlich kann oder nicht kann oder wie sich die Person fühlt – und entsprechend wird sie behandelt. Diese Ungleichbehandlung ist eine Art von Diskriminierung.“[13]
Das sind übrigens Themen, bei denen man sich gut an die eigene Nase fassen kann, reflektieren also über das eigene Verhalten. Um ein anschauliches Bild im Vergleich zu schaffen – Schöne Frauen mit langen Haaren sind “willig, aber dumm“.
Noch ein Abstecher – Die Schönheit der Differenz
Ich war im Dezember auf einer Lesung der Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Autorin Hadija Haruna-Oelker, deren Buch Die Schönheit der Differenz ich in meinem Adventskalender vorgestellt habe. In der Lesung hat sie aus ihrem aktuellen Buch Zusammensein – Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit gelesen. Sie stellt dort Fragen zur Umsetzung der Inklusion in unserer Gesellschaft und fragt, warum es immer noch an umfassender Teilhabe für behinderte Menschen fehlt und wie wir dem Erstarken sozialdarwinistischer Vorstellungen in unserer Gesellschaft entgegentreten. Interessant für mich war, dass sie auch aus ihren eigenen Erfahrungen schöpft, leider schöpfen kann, denn sie erlebt die Hürden der Bürokratie und Institutionen am eigenen Leib. Jedenfalls wusste ich bis dato nichts über die Zustände in Behindertenwerkstätten. Darüber schreibt sie auch in Die Schönheit der Differenz. So sind 2900 Werkstätten in Deutschland mit etwa 300 000 Angestellten mit etwa 180 Euro im Monat nicht mit dem Inklusionsgedanken vereinbar seien.[14] Nur ein Prozent wird von dort in den ersten Arbeitsmarkt überführt, „weil es viele Barrieren gibt, die diesen Übergang verhindern.“[15] 2021 wurden vier Menschen in einer Pflegeeinrichtung von einer Person getötet, die dort jahrelang gearbeitet hatte. Unter den Spekulationen für die Tat war auch die Aussage eines Polizeipsychologen, der „im rbb sogar ‘eine Motivation, die Leute zu erlösen, von Leiden, die vielleicht unheilbar sind’, als einen möglichen Grund für die Tat“[16] angab. Haruna-Oelker äußert sich dazu:
„Eine redaktionelle Einordnung erfolgte nicht. Diese Aussage wurde einfach stehen gelassen und versendet. Der Aufschrei erfolgte im Netz.
Menschen mit Behinderung müssen nicht von ihrem Leiden, sondern von dem Leid erlöst werden, das andere verursachen, die ihnen ein gutes Leben verwehren oder absprechen. Vom Leid der Diskriminierungen und Gewalt, damit sie ein sicheres, in ihren Rahmen selbstbestimmtes und langes Leben führen können, frei von wertenden und paternalistischen Blicken auf sie als die »Schutzlosen« und die »Schwächsten«. So fehlten am Tag nach der Tat in der Berichterstattung die Stimmen derjenigen, die es betrifft.“[17]
Gerade im Angesicht solcher Umfrageergebnisse wie weiter oben aufgeführt, sind solche Stimmen aus der Berichterstattung wichtig, weil sie weiter in die Tiefen solcher belasteten Themen vordringen und Schleier lüften. Julia Latscha erwähnt in ihrem Beitrag zu den Morden von Potsdam auch, dass gewaltvolle Übergriffe auf Menschen mit Behinderung kein Einzelfall seien.[18] „Eine 2012 vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene repräsentative Studie zeigt: Frauen mit Behinderung erfahren in der Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt zwei- bis dreimal häufiger als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Im Erwachsenenalter sind sie sogar fast doppelt so häufig von körperlicher Gewalt betroffen.“[19] Das erinnert mich an Die Cousinen von der argentinischen Autorin Aurora Venturini. Dort werden die gewalttätigen Strukturen der Gesellschaft mit patriarchalen Strukturen überblendet, sind die weiblichen Protagonistinnen auch in irgendeiner Art und Weise als körperlich oder geistig minderbemittelt beschrieben. Doch das ist nicht Deutschland. Wir haben unsere eigene Geschichte, wie erörtert. Auch darauf geht Haruna-Oelker ein.
Wie konnte es sein, dass die Ausführenden freigesprochen wurden?
Tatsächlich mag es absurd erscheinen, dass so viele Täterinnen und Täter damals freigesprochen wurden, weil sie sich irgendwie aus der Verantwortung ziehen konnten. „Es gab beträchtliche öffentliche Unterstützung für angeklagte Ärzte und Ärztinnen und Petitionskampagnen mit Hunderten Unterschriften, die eine Amnestie für die wenigen tatsächlich zu Haftstrafen verurteilten Personen forderten.“[20] In ihrer Studie geht Dagmar Herzog auf Fallbeispiele ein. „Der Umgang der Nachkriegspresse mit dem Fall Schmidt zeugte besonders deutlich von einer perversen Verdrehung der Wirklichkeit, da hier der Täter schwärmerisch sentimentalisiert und bemitleidet wurde, nicht aber die Opfer – die voller Abscheu als unvorstellbar missgebildet und monströs beschrieben wurden.“[21] Für mich persönlich wird gerade an solchen Beispiel deutlich, dass die Ideologe der Nationalsozialisten auf fruchtbaren Boden gefallen war. Auch hier liefert Helga Schubert mit Die Welt da drinnen neben ihren Recherchen zu den Opfern ein auf Fakten beruhendes Täterprofil des Dr. Alfred L. Zweimal war er angeklagt und freigesprochen worden. Im Gespräch mit der Schulklasse wird in Die Welt da drinnen weiter diskutiert.
Aber Auftrag, Loyalität, Verschwiegenheit und Pflichtbewusstsein reichen nicht für eine groß angelegte Aktion in einer Diktatur. Es fehlt noch etwas Entscheidendes.
Das hehre Ziel?
Ja, der Zweck, der die Mittel heiligt. Welchen Zweck verfolgen wir? Welche Ideologie beseelt uns und soll alles entschuldigen, was wir tun werden?
Wir wollen den Krieg gewinnen und müssen unsere Vorräte, unsere menschlichen Kräfte, unser medizinisches Personal, unsere Krankenhäuser, unsere Medikamente und unsere Nahrungsmittel möglichste sparsam und nutzbringend einsetzen, also für nichts Überflüssiges und nichts Unnötiges.
Zum Beispiel?
Nicht für Menschen, die nur daliegen und nichts Vernünftiges tun.
Am besten bezeichnen wir also diese als nutzlose Esser und Ballastexistenzen.
Aus: Schubert: Die Welt da drinnen, S. 279-280.
Treue, Loyalität und Verschwiegenheit – Die Ziele in schlimmen Zeiten bewahren
Daran anschließend kann ich Barbara Zoekes Die Stunde der Spezialisten mit dem Zitat aus Schuberts Die Welt da drinnen verbinden. Das folgende Gesprächsszenario macht die zugrundeliegende Systematik der Ermöglichung für das Morden deutlicher:
Professor Heyde, Professor Nitsche. Sie waren sehr ernst, geradezu streng. Ob ich die Schrift von Binding und Hoche gelesen hätte?
Ja, stotterte ich. Und wollte sofort den Titel aufsagen. Aber Heyde nannte ihn bereits:
Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form.
Ich habe sogar einen Vortrag zu diesem Thema gehört, ein Vortrag von Professor Hoche persönlich, warf ich schnell ein. Nitsche, der sich bisher zurückgehalten hatte, nickte anerkennend.
Dann wissen Sie ja Bescheid.
Heyde ließ ihn nicht weiter zu Wort kommen. Der Reichsärzteführer hat Sie als besonders verlässlich geschildert. Sie als SS-Offizier haben dem Führer unverbrüchliche Treue geschworen. Trauen Sie sich zu, diese Treue auch in schlimmen Zeiten zu bewahren? Auch dann, wenn Opfer von Ihnen verlangt werden, die Sie sich im Moment nicht einmal vorstellen können? Auch dann, wenn diese Opfer ganz im Geheimen gebracht werden müssen? Ohne Orden und ohne öffentliche Ehrungen, sondern still und unauffällig? Sie dürfen nicht einmal damit prahlen wie die jungen Soldaten auf Heimaturlaub, wenn die Alten ihnen Schnaps spendieren, damit sie berichten. Nicht einmal Ihrem Mädel dürfen Sie alles erzählen. Sie werden ziemlich allein damit sein. Sie werden Dinge tun müssen, die Ihnen nicht unbedingt passen. Aber Sie werden es für Ihr Volk tun. Und irgendwann wird dieses Volk, nach dieser Aktion gesund und stark wie kein Zweites, seine anonymen Helden zu würdigen wissen.
Aus Zoeke: Die Stunde der Spezialisten, S. 157.
Es fällt auf, dass alles „im Geheimen“ stattfinden soll, es darf nichts erzählt werden. Auch in Helga Schuberts Die Welt da drinnen wird „strengstes Stillschweigen“ (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 219) zur Aktion von den Ärzten gefordert. Wahrscheinlich macht so ein heldenmutiges Geheimnis im Namen der Treue auch wichtig, pusht das eigene Ego noch zusätzlich zur Beförderung und allem. Es erinnert mich an den Film Zone of Interest, in dem die Familie des KZ-Kommandanten Rudolf Höß direkt neben dem KZ von Auschwitz wohnt, die Frau Pelze der neu ankommenden Frauen ohne schlechtes Gewissen übernimmt, von der Stellung profitiert und den ganzen Tag den Tod vor den Augen hat.
Schweigen, Wegsehen, Hinsehen und danebenstehen
Das Schweigen und die Rolle der „Bystander“, der während der nationalsozialistischen “Euthanasie“-Programme sind zentrale Aspekte, die das moralische Versagen einer Gesellschaft beleuchten. Bystander (zu Deutsch: Zuschauer oder Unbeteiligte) sind Personen, die eine Situation beobachten, in der jemand Hilfe benötigt, ohne selbst einzugreifen oder zu helfen. Es dürfte also deutlich geworden sein, dass die Morde an den etwa 200.000 Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen nicht im Verborgenen, sondern inmitten der Gesellschaft geschahen. Viele Menschen wussten von den Vorgängen oder ahnten zumindest, was geschah, doch die Mehrheit schwieg. Ich denke, dass auch das Schweigen dazu beitrug, dass die Verbrechen ungehindert fortgesetzt werden konnten. Es war ein Schweigen, das nicht nur aus Angst, sondern auch aus einer moralischen Abstumpfung resultierte, die durch die systematische Entmenschlichung der Opfer gefördert wurde. Dieses Verhalten wirft bis heute Fragen nach individueller Verantwortung und kollektiver Schuld auf. Es zeigt, wie wichtig es ist, Unrecht zu benennen und sich aktiv dagegen zu stellen, um ähnliche Verbrechen in der Zukunft zu verhindern.
Das vielschichtige Schweigen angesichts der NS-“Euthanasie“
Das kollektive Schweigen angesichts der NS-“Euthanasie“ bildete eine komplexe, mehrschichtige Struktur, die den Massenmord erst ermöglichte. Diese „Architektur des Schweigens“ war kein zufälliges Phänomen, sondern ein systematisch erzeugter Zustand, der verschiedene gesellschaftliche Ebenen durchdrang und miteinander verband. Es gibt dazu auch jede Menge Studien, doch geht es mir hier einfach um das Phänomen des schweigenden Zusehens oder der Kenntnisnahme ohne Einwirkung. In einer Diktatur gibt es immer Menschen, die durch ein bisschen mehr Geld oder Macht verführbar sind oder die denken, dass die Sache nicht rauskommt“, so Helga Schubert im Interview zu ihrer Arbeit an Die Welt da drinnen und ihrer langjährigen Recherche zum Wesen der Diktatur. „Es sind kluge Leute, nicht diejenige, die die Diktatur nicht erkennen, sondern jene, die sie sich zunutze machen.“ (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 227) Ein Rückgrat brauche man zum Nein-Sagen, so Schubert. Wer kann so etwas in diesem System, diese Frage habe sie bereits in der DDR interessiert. (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 227)
Ein kleiner Teil des Ganzen – ein „nur“ im Morden
Im institutionellen Rahmen manifestierte sich das Schweigen als bürokratische Fragmentierung. Die „Aktion T4“ war so organisiert, dass jeder Beteiligte nur einen kleinen Ausschnitt des Gesamtprozesses überblickte. Das Konzept der Konformität, wie von Solomon Asch experimentell untersucht, und die Gehorsamsstudien Stanley Milgrams (Video im FAQ weiter unten) offenbaren die tiefe soziale Prägung menschlichen Verhaltens. Die soziale Distanz erlaubte vielen Beteiligten eine emotionale Abkopplung von den Konsequenzen ihres Handelns. Gleichzeitig zeigt das Konzept der moralischen Desensibilisierung nach Albert Bandura, wie die schrittweise Gewöhnung an ethische Grenzüberschreitungen zur vollständigen moralischen Abstumpfung führen kann. Auch dazu gibt es eine passende Passage aus der Diskussion mit der Schulklasse aus Die Welt da drinnen.
„Es gibt für jeden Täter das erste Mal, an dem noch nichts Routine ist. Nach dem ersten Mal kann er denken: Die anderen Tötungen sind auch nicht anders, nun kann ich nicht mehr zurück, es gibt Zeugen, ich bin in ihrer Hand, ich muss sie mitschuldig werden lassen, der Wagen hat sich in Bewegung gesetzt, auch wenn ich jetzt sofort aufhören würde, gab es dieses erste Mal, das ich nicht ungeschehen machen kann.
Aus: Schuber: Die Welt da drinnen, S 286.
Die Vernichtungspolitik wurde zudem durch eine Kultur der compartmentalization (Kompartmentalisierung) begünstigt – die Aufspaltung des Tötungsprozesses in kleine, scheinbar unverfängliche Teilschritte, die einzeln betrachtet ihre moralische Verwerflichkeit verschleierten. Diese „Fragmentierung der Verantwortung“ ermöglichte es vielen Beteiligten, ihre persönliche Verantwortung zu leugnen.
Ärzte füllten Meldebögen aus, ohne die Folgen ihrer Entscheidungen direkt zu sehen; Verwaltungsbeamte koordinierten Transporte, ohne den Zweck zu hinterfragen; Standesbeamte fertigten gefälschte Sterbeurkunden an, ohne ihren Anteil an der Täuschung zu reflektieren. Diese Parzellierung der Verantwortung erzeugte ein strukturelles Schweigen, das den moralischen Diskurs verhinderte. Das Schweigen wurde zur Voraussetzung reibungsloser Abläufe.
Auf sprachlicher Ebene entstand ein System der Verhüllung durch Euphemismen. Begriffe wie „Gnadentod“, „Erlösung“ oder „Behandlung“ verschleierten die tödliche Realität. Ich habe einmal ein Referat zu dem Propagandafilm Ich klage an (1941) gehalten, in dem eine an Multiple Sklerose erkrankte Frau ihren Mann – einen Arzt – um den Gnadentod bittet und sich letztlich in einem Gerichtsprozess aus sämtlichen Anklagepunkten herausargumentiert. Das ist natürlich Propaganda, aber es zeigt sich an solchen Beispielen wie diese Morde gerechtfertigt wurden – gerade vor allen Bevölkerungsgruppen, auch den Medizinern und Juristen.
Entmenschlichung der Opfer und Standardisierung von Morden
Die standardisierten Todesbenachrichtigungen mit fiktiven Todesursachen wie „Lungenentzündung“ oder „Herzversagen“ schufen eine Parallelsprache, die das Geschehen in einen pseudo-medizinischen Kontext rückte. Dieses euphemistische Vokabular ermöglichte es den Beteiligten, über die Tötungen zu kommunizieren, ohne sie zu benennen – ein Schweigen mitten im Sprechen.
Im medizinischen und wissenschaftlichen Diskurs entstand ein professionelles Schweigen durch semantische Transformation. Die Tötungen wurden nicht als Morde diskutiert, sondern als „therapeutische Maßnahmen“ oder „Rassenhygiene“ in einen pseudowissenschaftlichen Rahmen eingebettet. Fachzeitschriften publizierten euphemistische Artikel, medizinische Kongresse diskutierten „Lösungen“ für das „Problem“ der „Erbkranken“. Durch diese wissenschaftliche Neucodierung wurden ethische Fragen systematisch ausgeblendet – ein akademisches Schweigen, das den moralischen Diskurs durch technokratische Sprache ersetzte.
Besonders bedrückend war das Schweigen der Angehörigen. Tausende Familien erhielten Benachrichtigungen, deren Falschheit offensichtlich sein musste – plötzliche Todesfälle, unmittelbare Einäscherungen „aus seuchenhygienischen Gründen“, unerwartete Verlegungen. Dennoch protestierten nur wenige. Dieses Schweigen speiste sich aus verschiedenen Quellen: aus Angst vor Repressalien, aus Scham über die stigmatisierte Erkrankung des Familienmitglieds, aus Ohnmacht gegenüber staatlicher Autorität, manchmal auch aus verheimlichter Erleichterung über das Ende einer als belastend empfundenen Pflegesituation. Das Schweigen der Familien bildete ein entscheidendes Glied in der Kette der Ermöglichung. In Die Welt da drinnen gibt es dieses Mädchen, die bei ihrem Vater zuhause war, als dieser den gefälschten Brief mit der Todesnachricht seiner Tochter erhielt. Er schickte sie trotzdem wieder zurück in die Klinik, weil er wieder heiraten wollte und sie ihm lästig war.
Kollektives Schweigen – das Schweigen über das eigene Schweigen
Auf gesellschaftlicher Ebene etablierte sich eine Kultur des „Nicht-wissen-Wollens“. Die Tötungsanstalten waren keine verborgenen Einrichtungen – Rauch aus Krematorien war sichtbar, graue Transportbusse durchquerten Ortschaften, Gerüchte und Gerüche zirkulierten. „Ausflug ins Gas“ – heißt ein Kapitel in Helga Schuberts Die Welt da drinnen – Ausflug ins Blaue im wahrsten Sinne. Und überall gibt es „nurs“. „Ich bin hier nur der Kraftfahrer“ sagt sich der Fahrer der Todesbusse und versucht, niemandem ins Gesicht zu sehen und die Fragen nach dem Ziel des Ausflugs zu überhören. (Schubert: Die Welt da drinnen, S. 65). Überhaupt ist mir die Verwendung des Wortes „nur“ in Die Welt da drinnen aufgefallen. „Nur“ wird in Zusammenhang mit Schuld oder Ausreden oft als Relativierung oder Verharmlosung verwendet, um die eigene Verantwortung zu minimieren. Natürlich wusste der Busfahrer, wo er die Menschen hinfährt. Die lokale Bevölkerung entwickelte Strategien des selektiven Wegsehens und Weghörens. Diese paradoxe Form des aktiven Nicht-Wahrnehmens erforderte kontinuierliche Anstrengung – ein angestrengtes Schweigen, das die Normalität des Alltags aufrechterhalten sollte.
Nach Kriegsende transformierte sich das Schweigen in eine neue Gestalt: das Schweigen über das eigene Schweigen. In Gerichtsprozessen und öffentlichen Debatten dominierte der Verweis auf Unwissenheit und Handlungszwang. Die juristische Aufarbeitung scheiterte oft an der Unmöglichkeit, das vielschichtige System des Schweigens rückwirkend aufzubrechen. Die Freisprüche vieler beteiligter Ärzte verfestigten das Nachkriegsschweigen und verhinderten eine tiefergehende gesellschaftliche Auseinandersetzung. Die wenigen Stimmen, die das Schweigen durchbrachen – eine deutliche Stimme war damals beispielsweise der Protest des Bischofs von Galen mit seiner Predigt in Münster – bleiben bedeutsam, weil sie demonstrieren, dass Schweigen keine unausweichliche Reaktion, sondern eine Entscheidung war. Sie zeigen, dass das vielschichtige System des Schweigens Risse hatte, die für Intervention genutzt werden konnten. Die Rolle der Kirchen ist allerdings auch vielschichtig und ambivalent zu betrachten. Damals wie heute, wenn man sich die Studien der Evangelischen Kirche zum Missbrauch ansieht und auch die Skandale der katholischen Kirchen zeigen, dass institutionelles Schweigen und Verheimlichen gang und gäbe ist.
Das Phänomen des kollektiven Schweigens während der NS-“Euthanasie“ konfrontiert uns mit der beunruhigenden Erkenntnis, dass Schweigen nicht neutral ist, sondern aktiv wirkt. Es war kein passives Nicht-Handeln, sondern eine Form der Komplizenschaft, die den Massenmord erst ermöglichte und stabilisierte. Die historische Analyse dieses vielschichtigen Schweigens bleibt eine anhaltende ethische Herausforderung für unser Verständnis institutioneller und gesellschaftlicher Verantwortung.
Bischof von Galen und seine Predigt zur NS-„Euthanasie“
Ein Auszug aus der Predigt in Münster, in der Bischof von Galen konkret auf die NS-Euthanasie zu sprechen kommt:
«Seit einigen Monaten hören wir Berichte, dass aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. Regelmässig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, der Kranke sei verstorben, die Leiche sei verbrannt, die Asche könne abgeliefert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, dass diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe so genannt lebensunwertes Leben vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert. Eine furchtbare Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt!» […] Dann ist keiner von uns seines Lebens mehr sicher. Irgendeine Kommission kann ihn auf die Liste der Unproduktiven setzen, die nach ihrem Urteil lebensunwert geworden sind. Und keine Polizei wird ihn schützen und kein Gericht seine Ermordung ahnden und den Mörder der verdienten Strafe übergeben. Wer kann dann noch Vertrauen haben zu einem Arzt? Vielleicht meldet er den Kranken als unproduktiv und erhält die Anweisung, ihn zu töten? […] Wehe den Menschen, wehe unserem deutschen Volk, wenn das heilige Gottesgebot: «Du sollst nicht töten!», das der Herr unter Donner und Blitz auf Sinai verkündet hat, das Gott unser Schöpfer von Anfang an in das Gewissen der Menschen geschrieben hat, nicht nur übertreten wird, sondern wenn diese Übertretung sogar geduldet und ungestraft ausgeübt wird! […]
Auch Barbara Zoeke integriert die Predigt von Galens in Die Stunde der Spezialisten und fügt noch etwas hinzu:
Am ersten Sonntag im August 1941 predigte der Bischof von Münster. In der Kirche Sankt Lamberti, an deren Turm einst die Leichen der Wiedertäufer in eisernen Körben aufgehängt wurden. Ebendort verzichtete von Galen auf alle Umschreibungen. Er sprach nicht von der Aktion E, schon gar nicht von Euthanasie. Er nannte Mord Mord.
Die Predigt des Bischofs wurde abgetippt und ging von Hand zu Hand. Vor den katholischen Westfalen hatten sie in Berlin ein bisschen Angst. Es war Krieg. Unruhe wollten sie nicht. Der FÜHRER stoppte den Mord an den Kranken. Am 24.August 1941 stoppte er ihn.
Sagten sie.
Versprachen sie.
Hielten sie aber nicht.
Aus: Zoeke: Die Stunde der Spezialisten, S. 243.
Meine Berührungspunkte mit dem Thema von Die Welt da drinnen
Mit der nationalsozialistischen “Euthanasie“ bin ich das erste Mal während einer Ausarbeitung in der Oberschule in Berührung gekommen. Das Thema selbst haben wir dort gar nicht behandelt, aber ich habe immer mehr dazu gelesen, mir Dokumentationen angeschaut, auch wenn ich die Informationen damals nicht nutzen konnte. Auch in der Studienzeit gab es Berührungspunkte und danach hatte ich nach einem Praktikumsplatz in der Gedenkstätte Hartheim angefragt und wollte mich für eine Stelle in einer niedersächsischen Behörde für Erinnerungsarbeit bewerben. Daraus ist dann nichts geworden, doch läuft mir das Thema immer wieder über den Weg. Ich habe mich lange gefragt, warum mich dieses Thema so intensiv anzieht. Ich hatte schon im Kindergarten, in der Grundschule und eigentlich seit ich mich erinnern kann ein Interesse für Gruppendynamiken und schon früh festgestellt: Wenn ich mich für die Leute einsetze, die aus irgendeinem Grund (und das kann wirklich alles sein) ausgegrenzt und gemobbt werden, dann werde ich selbst zur Zielscheibe oder aber meine Motivation wird von eben diesen Menschen selbst missverstanden. Ich habe mich auch im Studium richtig in das Thema eingegraben und dann festgestellt, dass über einen derartigen Sachverhalt ebenso theoretisch gesprochen wurde wie über das Töten von “Ballastexistenten“. Das hat mich erschreckt und zugleich wütend gemacht – musste ich mir auch Emotionalität vorwerfen lassen, die nicht in den akademischen Kontext gehört. Gerade aus diesem Grund habe ich auch den Ansatz von Helga Schubert zitiert, wie sie in der Schulklasse sitzt und diesen jungen Menschen diese Frage stellt, diesen Geheimauftrag gibt. Und alle sagen Nein. Nur um dann zwei Stunden später – nach theoretischen Diskussionen (die ja auch in Gedanken auch keinen Schaden anrichten) – zu eben ähnlichen Mechanismen zu gelangen, die ausgeführt worden sind. Ganz allgemein interessiere ich mich für das Verhalten von Menschen und mich interessiert vor allem die literarische Verarbeitung, die Inszenierung, die Motivation der Autorinnen und Autoren zum Verfassen dieser Texte mit einer möglichen Involviertheit und der Frage, ob sich etwas durch diese Publikation und dem Aufzeigen von Missständen in der Literatur ändern kann. Es geht neben vielen anderen Aspekten auch um totalitär ausgerichtete institutionelle Systeme, die paradoxerweise eben an derartigen Thematiken forschen und letztlich doch gerade diese Formationen des Mitläufertums und Bewahrens der diktatorischen Strukturen in einer aktualisierten Form weiter prägen. Verschiedene Formen von Druck und Einschüchterung, Erpressung und vermeintlichem Gutmenschentum existieren nach wie vor, da sollte man sich nicht von blenden lassen. Ich weiß mittlerweile, dass ich Nein sagen kann. Aber wie hätte ich damals gehandelt, wenn ich in irgendeiner Weise involviert gewesen wäre? Das beschäftigt mich in der Auseinandersetzung mit solchen Themen immer.
Beschluss zu Die Welt da drinnen und diesem Essay
Dass Helga Schuberts Buch nun neu herausgegeben wurde, ist ein Zeugnis der Anerkennung für ihre Arbeit und auch für einen neuartigen Umgang und Kenntnisnahme der Perspektive vieler Opfer, die damals nicht für sich selbst eintreten konnten und für die lange Zeit niemand eintreten wollte. Jetzt werden sie gehört. In die Welt da drinnen sind es stellvertretend einige Einzelschicksale aus der Schweriner Klinik. So beginnt und schreitet die detaillierte Reflexion über die Opfer, Täterinnen und Täter fort – eine Aufarbeitung, die gerade erst begonnen hat. Ist eine Wiederholung möglich? Nein – sollte man sagen können. Es darf einfach nicht wieder so weit kommen! Doch gerade, dass es vereinzelte Stimmen gibt, die zwischen wertem und unwertem Leben unterscheiden und sich zu Gruppen zusammenschließen, die wachsen – das ist alarmierend, finde ich. Wir sollten doch aus der Geschichte etwas lernen, nicht wahr? Es ist nicht einfach damit abgetan, zu sagen, Geschichte wiederhole sich sowieso oder, dass Menschen halt so seien. Ich denke, wir können dazulernen und wir können auch aus Geschichte lernen, wir können aus Geschichten lernen, aus faktual-literarischen Geschichten über die Opfer, die nicht für sich selbst sprechen konnten. Ihre Erzählungen werden in Die Welt da drinnen durch Originalakten gestützt – das ist geschehen, es gibt Beweise. Auch, wenn es nicht leicht scheint, das Buch zu lesen; wenn die Geschichten möglicherweise schwer verdaulich sein mögen – die Auseinandersetzung mit den Opfern ist meines Erachtens nach mit reflektierenden Fragen verbunden, die wir uns alle stellen können. Denn die Zeit zum Handeln, zum Brechen des Schweigens und zum Nein-Sagen, die liegt immer im Jetzt. Nein-Sagen zu Ausgrenzung, Diskriminierung und Diffamierung und zu Gewalt ist eine Entscheidung, die immer jetzt getroffen werden kann. Und ich glaube, dass jede und jeder mindestens einmal in seinem Leben vor eine solche Entscheidung gestellt sein wird – egal, in welchem Kontext. Enden will ich aber mit einem Zitat aus dem Beitrag von Christel Dorothee Roer:
„‘Opfer’ und Überlebende brauchen wir, um nicht zu vergessen, dass Menschen Geschichte machen, also auch wir. Wir brauchen ihre Erzählung, um uns daran zu erinnern, dass und wie die faschistische Vergangenheit in die Gegenwart hineinragt und unser Handeln prägt, um den Blick dafür zu schärfen, dass unsere Gesellschaft strukturelle Homologien mit der des ‘Dritten Reichs’ aufweist, dass hier und heute immer noch, und immer mehr zwischen Tüchtigen und Untüchtigen unterschieden wird, die Tüchtigen (Lebenswerten?) gefördert, die Untüchtigen (Lebens-Unwerten?) ausgesondert werden. Die Geschichten der Opfer können uns warnen und helfen, aus der Geschichte zu lernen. In diesem Sinn lehren uns auch die Zeitzeugen der Verbrechen in der Psychiatrie zwischen 1933 und 1945 viel und Konkretes, wenn wir ihnen nur zuhören. Sie erinnern an die Menschenwürde und ihre Beschädigung, sie sprechen über Menschenrechte und wie sie schleichend ausgehöhlt werden können, über die Indienstnahme der Wissenschaft für die Zwecke der Herrschenden, über den hippokratischen Eid und seine Demontage, um nur einige Themen zu nennen.“[22]
- Der Zauberer von Oz: Conditio humana im blinden Fleck der Figuren – 10. Februar 2026
- Tristan und Isolde im Kartenspiel: Zwischen mittelalterlicher Tradition und romantischer Umdeutung – 12. Januar 2026
- Das Jesus Video – Andreas Eschbachs Science-Fiction-Thriller über Zeitreisen und Glauben – 24. Dezember 2025
Verwendete Literatur
Binding, Karl/Hoche, Alfred: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens – Ihr Maß und ihre Form. Zweite Auflage. Leipzig 1922, S. 29-32. (Online unter: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/varia/content/titleinfo/8796938, zuletzt aufgerufen am 21.04.2025).
Bocksch, René: Rechtsextreme Positionen finden Anklang bei AfD-Wähler:innen, 16.01.2024, online unter: https://de.statista.com/infografik/31574/anteil-der-befragten-die-diesen-rechtsextremen-positionen-zustimmen/ (zuletzt abgerufen am 24.04.2025).
Clemens August Graf von Galen: Predigt in Münster, in der Bischof von Galen, Textquelle: Bischöfliches Generalvikariat Münster, online unter: https://www.luebeckermaertyrer.de/de/geschichte/predigten-von-galens/predigt-3.html (zuletzt abgerufen am 24.04.2025).
„Die Welt da drinnen“. Im Gespräch mit Helga Schubert. In: Verdrängt. Die Erinnerung an die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde. Herausgegeben vom Bezirk Oberbayern durch das Zentrum Erinnerungskultur der Universität Regensburg (Jörg Skriebeleit und Winfried Helm). Göttingen 2023, S. 222-231.
Haruna-Oelker: Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken. München 2023.
Herzog, Dagmar: Eugenische Phantasmen. Eine deutsche Geschichte. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2021. Aus dem Amerikanischen von Ulrike Bischoff. Berlin 2024.
Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen [zum Sozialdarwinismus] zu? Veröffentlicht vom Statista Research Department am 14.11.2024, Quelle Uni Leipzig, online unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/562634/umfrage/umfrage-zum-sozialdarwinismus-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen am 24.04.2025).
Latscha, Julia: Dieser Tod ist keine Erlösung. Zeit online, 11. Mai 2021, online unter: https://www.zeit.de/kultur/2021-05/behindertenfeindlichkeit-mord-potsdam-pflegerin-inklusion-ableismus-erloesung (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).
Roer, C. Dorothee: Zeugenschaft als subjektive und soziale Herausforderung. In: NS-„Euthanasie“ und Erinnerung. Vergangenheitsaufarbeitung – Gedenkformen – Betroffenenperspektiven. Hrsg. von Stefanie Westermann, Richard Kühl, und Tim Ohnhäuser. Berlin 2011 (Medizin und Nationalsozialismus 3), S. 29-42.
Schubert, Helga: Die Welt da drinnen. Eine deutsche Nervenklinik und der Wahn vom unwerten Leben. Mit einem Vorwort der Autorin. München 2021, hier S. 258.
Was ist Ableismus, online unter: https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/ableismus (zuletzt abgerufen am 23.04.2025).
Zoeke, Barbara: Die Stunde der Spezialisten. Berlin 2017, S. 176.
FAQ: Nationalsozialistische „Euthanasie„ und Aktion T4
Was versteht man unter der nationalsozialistischen "Euthanasie"?
Unter der sogenannten „Euthanasie“ (ein beschönigender Begriff) versteht man die systematische Ermordung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, geistigen und körperlichen Behinderungen im nationalsozialistischen Deutschland. Diese Verbrechen wurden nicht zur „Linderung von Leiden“ begangen, sondern aus ideologischen, ökonomischen und rassenhygienischen Motiven.
Was war die Aktion T4?
Die Aktion T4 war ein Programm der nationalsozialistischen Regierung, das zwischen 1939 und 1941 durchgeführt wurde. Ziel war die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, die als „lebensunwert“ angesehen wurden.
Wer befahl die Aktion T4?
Adolf Hitler unterzeichnete im Oktober 1939 eine rückdatierte und geheime Ermächtigung („Hitler-Erlass“), die bestimmten Ärzten und Verwaltungskräften die Tötung von „unheilbar Kranken“ erlaubte. Damit war die Aktion T4 offiziell gedeckt.
Wer war für die Aktion T4 verantwortlich?
Die Aktion wurde von der Kanzlei des Führers organisiert, unter der Leitung von Philipp Bouhler und Karl Brandt. Ärzte und Verwaltungsbeamte waren direkt an der Durchführung beteiligt. Die Aktion T4 war das zentrale organisierte Tötungsprogramm der Nationalsozialisten.
Benannt ist sie nach der Tarnadresse der Zentrale in Berlin: Tiergartenstraße 4.
Wie wurde die Aktion T4 durchgeführt?
Patientinnen und Patienten aus psychiatrischen Einrichtungen wurden in speziell eingerichtete Tötungsanstalten gebracht, wo sie durch Vergasung, Medikamente oder gezielte Unterernährung ermordet wurden. Insgesamt gab es sechs Haupttötungsanstalten, darunter Grafeneck und Hadamar.
Wie viele Menschen wurden ermordet?
Im Rahmen der Aktion T4 wurden etwa 70.000 Menschen ermordet. Insgesamt fielen den Euthanasie-Verbrechen des NS-Regimes bis zu 300.000 Menschen zum Opfer.
Welche Reaktionen und Konsequenzen gab es?
Die Aktion T4 stieß auf Widerstand, unter anderem von Kirchenvertretern wie Clemens August Graf von Galen. Nach öffentlicher Kritik wurde die zentrale Phase der Aktion 1941 offiziell beendet, jedoch wurden die Morde dezentral fortgesetzt. Online kann man die Predigt des Bischofs von Münster in der Lambertikirche in Münster nachlesen.
Ein Zitat daraus:
„[…] Dann ist keiner von uns seines Lebens mehr sicher. Irgendeine Kommission kann ihn auf die Liste der Unproduktiven setzen, die nach ihrem Urteil lebensunwert geworden sind. Und keine Polizei wird ihn schützen und kein Gericht seine Ermordung ahnden und den Mörder der verdienten Strafe übergeben. Wer kann dann noch Vertrauen haben zu einem Arzt? Vielleicht meldet er den Kranken als unproduktiv und erhält die Anweisung, ihn zu töten? […]“
Wer waren die Täterinnen und Täter sowie Opfer?
Bei den Täterinnen und Täter handelte es sich um Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungsbeamte, die aktiv an der Planung und Durchführung beteiligt waren. Die Opfer waren Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie psychischen Erkrankungen.
Wie wird heute an die Opfer erinnert?
Heute wird auf vielfältige Weise an die Opfer der NS-„Euthanasie“ erinnert:
- Gedenkstätten an historischen Orten: An ehemaligen Tötungsanstalten wie Hadamar, Grafeneck, Brandenburg, Bernburg, Pirna-Sonnenstein und Hartheim wurden Gedenkstätten mit Ausstellungen, Dokumentationszentren und pädagogischen Angeboten eingerichtet. Diese Orte sind zentrale Erinnerungsräume, die sowohl historische Information als auch würdevolles Gedenken ermöglichen.
- Stolpersteine und Namensnennung: In vielen Städten erinnern „Stolpersteine“ vor ehemaligen Wohnhäusern an Euthanasie-Opfer. Das T4-Denkmal in Berlin (eröffnet 2014) nennt erstmals die Namen tausender Ermordeter und gibt den anonymisierten Opfern ihre Identität zurück.
- Gedenkbücher und Personalisierung: Zahlreiche Projekte bemühen sich um die namentliche Erfassung und Biografierecherche der Opfer, um sie aus der anonymen Masse zu lösen und als Individuen zu würdigen.
- Institutionelle Aufarbeitung: Psychiatrische Kliniken, medizinische Fakultäten und Gesundheitseinrichtungen haben ihre historische Verstrickung aufgearbeitet und erinnern mit Gedenktafeln, Ausstellungen und Veranstaltungen an ihre ermordeten Patienten.
- Gedenktag 27. Januar: Am Holocaust-Gedenktag wird zunehmend auch der Euthanasie-Opfer gedacht, die lange im Schatten anderer NS-Opfergruppen standen.
- Inklusive Erinnerungskultur: Besonders wichtig sind heute inklusive Erinnerungsformate, die Menschen mit Behinderungen aktiv einbeziehen und in leichter Sprache zugänglich sind.
- Digitale Archive und Projekte: Initiativen wie „Gedenkort T4“ arbeiten digital zugänglich.
Wer führte die Morde aus?
- Ärzte und Pflegepersonal, die Diagnosen stellten oder Tötungen durchführten
- Verwaltungsbeamte und Juristen, die Verfahren regelten
- SS- und Polizeikräfte, die Transporte organisierten
- Technisches Personal, das Gaskammern betrieb
Zentrale Figuren waren z. B. Viktor Brack, Philipp Bouhler und Karl Brandt.
Wie lief die Aktion T4 ab?
- Meldung: Psychiatrische Anstalten meldeten Patientendaten auf Meldebögen an die T4-Zentrale.
- Begutachtung: Ärzte entschieden anhand der Bögen, ohne die Patienten zu sehen, über Leben und Tod.
- Transport: Patienten wurden in Zwischenanstalten und dann in Tötungsanstalten gebracht.
- Mord: In sechs zentralen Tötungsanstalten wurden die Menschen durch Gas, Medikamente oder Nahrungsentzug getötet.
- Vertuschung: Todesursachen wurden gefälscht, Familien belogen.
Wie viele Menschen starben durch die NS-"Euthanasie"?
Im Rahmen der Aktion T4: etwa 70.000 Menschen.
Im weiteren Verlauf (Dezentralisierung, sogenannte „wilde Euthanasie“): insgesamt etwa 200.000 Menschen.
Gab es öffentliche Reaktionen?
Ja.
Als sich Berichte über das Vorgehen häuften, kam es ab 1940/41 zu Widerstand:
Kirchlicher Protest: Besonders bekannt ist die Predigt von Bischof Clemens August Graf von Galen, der die Morde öffentlich anprangerte
Öffentlicher Druck: Wachsende Unruhe in der Bevölkerung zwang Hitler, die zentrale Aktion T4 im August 1941 offiziell zu stoppen. Die Morde gingen allerdings dezentral weiter.
Wer waren die Opfer?
- Psychiatrische Patienten
- Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung
- Menschen mit chronischen Erkrankungen
- Kinder mit Entwicklungsstörungen
- Später auch Arbeitsunfähige, NS-Opfergruppen und sogenannte „asoziale Elemente“
Was passierte mit den Tätern nach 1945?
Viele Täter entzogen sich zunächst der Strafverfolgung. In den 1960er Jahren kam es zu einigen Prozessen, etwa dem Hadamar-Prozess. Viele Verantwortliche wurden nie belangt oder setzten ihre Karrieren im Nachkriegsdeutschland fort.
[1] C. Dorothee Roer: Zeugenschaft als subjektive und soziale Herausforderung. In: NS-„Euthanasie“ und Erinnerung. Vergangenheitsaufarbeitung – Gedenkformen – Betroffenenperspektiven. Hg. von Stefanie Westermann, Richard Kühl, und Tim Ohnhäuser. Berlin 2011 (Medizin und Nationalsozialismus 3), S. 29-42, hier S. 29. [2] Ebd., S. 31. [3] Ebd., S. 32. [4] Ebd., S. 39. [5] Ebd. [6] Es gibt ein Interview in einem populärwissenschaftlichen Buch, geführt von Caroline Emig vom Zentrum für Erinnerungskultur der Universität Regensburg, in dem Helga Schuber auch darauf eingeht: „Die Welt da drinnen“. Im Gespräch mit Helga Schubert. In: Verdrängt. Die Erinnerung an die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde. Herausgegeben vom Bezirk Oberbayern durch das Zentrum Erinnerungskultur der Universität Regensburg (Jörg Skriebeleit und Winfried Helm). Göttingen 2023, S. 222-231. [7] Die Idee der Kollektivschuld, wie sie etwa von Karl Jaspers in seiner Schrift Die Schuldfrage (1946) diskutiert wurde, verweist auf die Verantwortung einer gesamten Gesellschaft für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Das Buch kann hier eingesehen werden. [8] Herzog, Dagmar: Eugenische Phantasmen. Eine deutsche Geschichte. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2021. Aus dem Amerikanischen von Ulrike Bischoff. Berlin 2024, S. 24-25. [9] Ebd., S. 100. [10] Binding, Karl/Hoche, Alfred: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens – Ihr Maß und ihre Form. Zweite Auflage. Leipzig 1922, S. 29-32. (Online unter: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/varia/content/titleinfo/8796938, zuletzt aufgerufen am 21.04.2025). [11] Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen [zum Sozialdarwinismus] zu? Veröffentlicht vom Statista Research Department am 14.11.2024, Quelle Uni Leipzig, online unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/562634/umfrage/umfrage-zum-sozialdarwinismus-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen am 24.04.2025). [12] Bocksch, René: Rechtsextreme Positionen finden Anklang bei AfD-Wähler:innen, 16.01.2024, online unter: https://de.statista.com/infografik/31574/anteil-der-befragten-die-diesen-rechtsextremen-positionen-zustimmen/ (zuletzt abgerufen am 24.04.2025). [13] Was ist Ableismus, online unter: https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion/ableismus (zuletzt abgerufen am 23.04.2025). [14] Haruna-Oelker: Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken. München 2023, S. 462. [15] Ebd. [16] Latscha, Julia: Dieser Tod ist keine Erlösung. Zeit online, 11. Mai 2021, online unter: https://www.zeit.de/kultur/2021-05/behindertenfeindlichkeit-mord-potsdam-pflegerin-inklusion-ableismus-erloesung (zuletzt abgerufen am 23.04.2025). [17] Die Schönheit der Differenz, S. 462-463. [18] Latscha, Julia: Dieser Tod ist keine Erlösung. Zeit online, 11. Mai 2021, online unter: https://www.zeit.de/kultur/2021-05/behindertenfeindlichkeit-mord-potsdam-pflegerin-inklusion-ableismus-erloesung (zuletzt abgerufen am 23.04.2025). [19] Ebd. [20] Herzog: Eugenische Phantasmen, S. 101. [21] Ebd. [22] Roer: Zeugenschaft als subjektive und soziale Herausforderung, S. 39.
fsdgdsgdfgdf